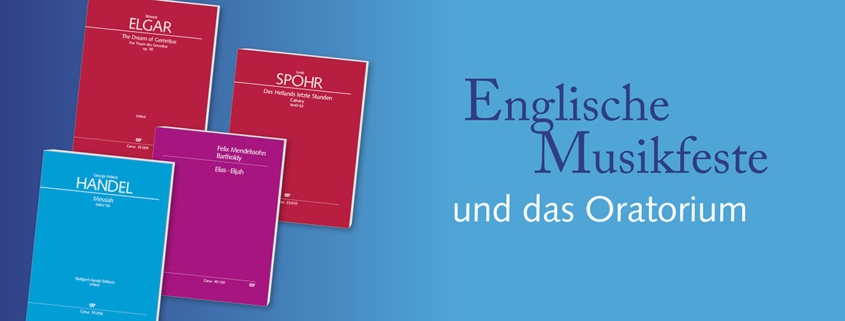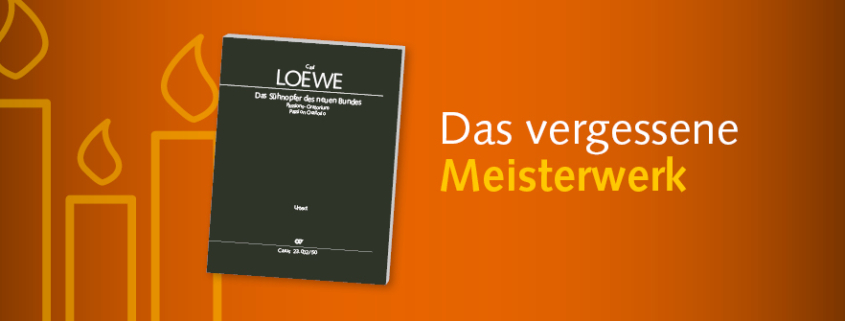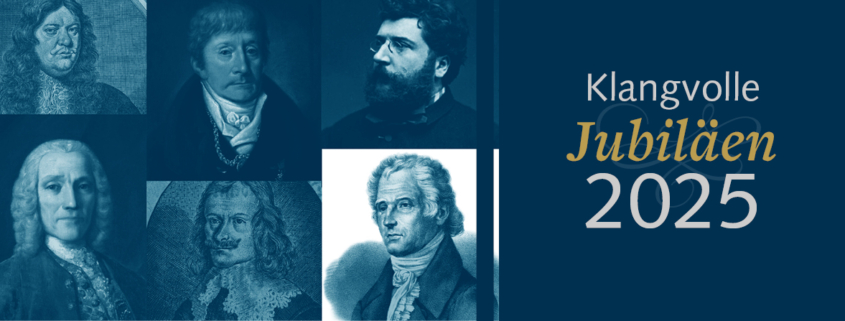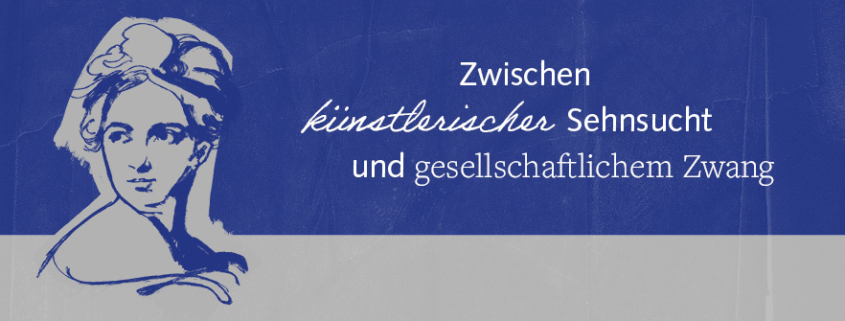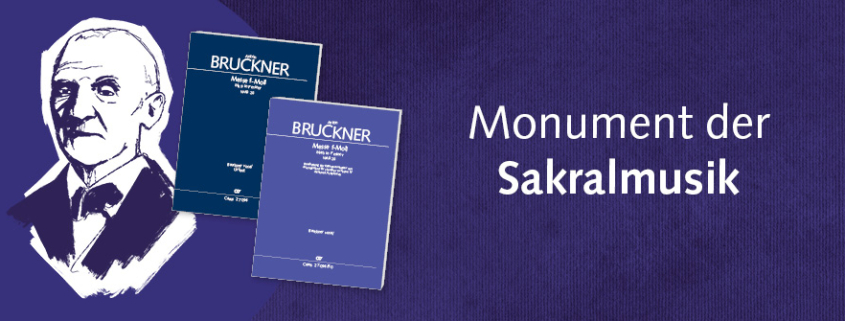Mit Händel fing alles an…
Georg Friedrich Händel ist der Schöpfer des englischen Oratoriums. Als er 1732 seine Esther als geistliches Drama ohne szenische Aktion erstmals auf die Bühne des Londoner King‘s Theatre brachte, begann eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Das Opernpublikum begeisterte sich so sehr für die neue Gattung, dass Händel, der nicht nur Komponist, sondern auch Theatermanager war, fortan mit Oratorien über biblische Stoffe seine Opernhäuser füllte. Den Messiah und später auch andere Oratorien zu karitativen Zwecken aufzuführen, war vor allem einer der Triebkräfte für die Entwicklung der großen Musikfeste, die seit dem frühen 18. Jahrhundert zunächst in Großbritannien und etwas später auch in Deutschland und anderen Ländern veranstaltet wurden.