Marianna von Martines
Eine feste Größe im Wiener Musikleben
Das aristokratische Wien Ende des 18. Jahrhunderts. An einer Person kommt man im Musikleben nicht vorbei: Marianna von Martines (1744 – 1812). Zu Lebzeiten ist sie eine Institution und sowohl als Interpretin und Lehrerin als auch als Komponistin hoch angesehen. In den Berichten von seinen Europareisen lobte der englische Musikhistoriker Charles Burney ihren Gesang und ihr Klavierspiel. Es ist gut möglich, dass Martines für Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph II. musizierte. In ihren späteren Jahren komponierte Martines weniger, sondern widmete sich vermehrt ihrer renommierten Gesangsschule und ihren musikalischen Salons, die von einigen der prominentesten Musiker*innen Wiens besucht wurden.
Der Erfolg kam nicht von ungefähr: Während ihrer gesamten Kindheit wurde die Ausbildung der jungen Marianna von einem engen Freund ihres Vaters, dem berühmten Dichter und Librettisten Pietro Metastasio begleitet, der bis zu seinem Tod im Jahr 1782 bei der Familie Martines lebte. So erhielt sie z.B. Klavierunterricht beim jungen Joseph Haydn (der nach seinem Rauswurf aus dem Chor des Stephansdoms in die Mansarde über der Wohnung der Familie Martines eingezogen war), Gesangs- sowie Kompositionsunterricht.
Heute wird Marianna von Martines in zunehmendem Maße die Anerkennung zuteil, die ihr als bedeutende Komponistin des 18. Jahrhunderts gebührt.
Marianna von Martines
Martines als Komponistin
Viele von Martines‘ Kompositionen sind Motetten und Kantaten für Solostimme und Tasteninstrument, die sie oft selbst aufführte. Daneben komponierte sie Klaviermusik, eine Sinfonie und eine Reihe von geistlichen Chor- und Orchesterwerken, darunter vier Messen und zwei Oratorien. Zwar gibt es keine Hinweise darauf, dass Martines jemals Wien verlassen hätte, aber ihre Kompositionen fanden auch im Ausland großen Anklang. Mit nur 29 Jahren wurde sie im Jahr 1774 als erste Frau überhaupt in die renommierte Accademia Filarmonica von Bologna aufgenommen – ein großer Erfolg für die junge Künstlerin. Der Accademia, die die besten Musiker*innen Europas vereinen sollte, gehörten u.a. auch Johann Christian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart an. In dieser Zeit entstand ein weiteres Meisterwerk, denn die Accademia erwartete von allen neuen Mitgliedern eine Vertonung des Psalmtextes Dixit Dominus. Martines‘ majestätische Vertonung für Chor, Solist*innen und Orchester ist heute eines ihrer meistaufgeführten Chorwerke.
Im Zuge ihrer Bewerbung an der Accademia gewährt Martines Einblick in ihre kompositorische Ausbildung und Vorgehensweise. In einem Schreiben aus dem Jahr 1773 an Padre Giovanni Battista Martini an der Accademia betonte sie ausdrücklich sowohl ihre Beherrschung des neuesten galanten Stils als auch ihre Kenntnis der erlernten Techniken des Barock.
„Meine Aufgabe war und ist es, die ständige tägliche Praxis des Komponierens mit dem Studium und der Analyse von Werken der berühmtesten Meister wie Hasse, Jomelli, Galluppi und anderen zu verbinden, die heute berühmt sind und für ihre musikalische Arbeit gepriesen werden – ohne dabei die ältere [Generation] wie Händel, Lotti, Caldara und andere zu vernachlässigen. “ (Martines an Martini, 16. Dezember 1773)
Die Seconda Messa
Martines‘ Synthese und Beherrschung alter und neuer Stile ist ein zentrales Thema in ihren Werken, worauf in der musikwissenschaftlichen Literatur häufig hingewiesen wird. Besonders deutlich wird die Stilsicherheit in ihren geistlichen Chor- und Orchesterwerken. Ihre Seconda Messa komponierte Martines im Alter von gerade einmal sechzehn Jahren. Damit handelt es sich um ihre früheste datierte Komposition – und möglicherweise sogar um ihr frühestes erhaltenes Werk überhaupt. Die Messe Nr. I ist undatiert, und vieles spricht dafür, dass sie später komponiert wurde. Während ihre anderen Messen mit großem Orchester (u.a. Oboen und Trompeten, und manchmal Pauken) besetzt sind, ist die Seconda Messa größtenteils für das damals übliche und elegante „Kirchentrio“ mit zwei Violinen und Continuo geschrieben. Nur im Benedictus wird die Besetzung um zwei obligate Posaunen erweitert. Posaunen waren in der Wiener Kirchenmusik weit verbreitet und füllten in der Regel die Textur durch Verdoppelung der Chorstimmen aus. Unabhängige Posaunenstimmen wie im Benedictus der Missa Seconda sind jedoch ungewöhnlich und verleihen der ansonsten traditionellen Besetzung eine gewisse Besonderheit.
Dr. Joseph Taff ist Chorleiter, der sich darüber hinaus in seiner wissenschaftlichen Arbeit auf die Werke von Marianna von Martines fokussiert. Insbesondere seine Dissertation über ihre Messen ist preisgekrönt. Er ist Assistenzprofessor und Leiter der Chorprojekte an der Thomas More University in Crestview Hills, Kentucky, sowie musikalischer Leiter der Presbyterian Church of Wyoming, Ohio.
Die Struktur der Messe ist einfach und elegant. Während Martines‘ Terza und Quarta Messae als „Kantatenmessen“ mit ausgedehnten und mehrsätzigen Vertonungen des Gloria und Credo aufgebaut sind, vertont Martines die beiden langen Texte in der Seconda Messa als Einzelsätze. Die Deklamation des Chores ist klar und prägnant, ohne Wiederholungen oder Ausdehnungen. Soli und Duette (wie das Christe und das Benedictus) haben eine einfache zweiteilige Struktur, wobei der erste Teil in die dominante Tonart moduliert und der zweite Teil zurückkehrt. Martines verwendet häufig die heute als „galante Schemata“ bezeichneten Gesten und beweist damit ihre Beherrschung des modernsten Stils. Gleichzeitig stellt sie ihre Beherrschung des stile antico unter Beweis, indem sie an mehreren traditionellen Stellen geschickte Fugen schreibt: das zweite Kyrie, die Schlusszeilen des Gloria und des Credo („cum Sancto Spiritu“ und „et vitam venturi saeculi“) und das wiederholte Osanna, das sowohl das Sanctus als auch das Benedictus beschließt.
Es gibt keinen Beleg dafür, dass die Seconda Messa zu Lebzeiten von Martines aufgeführt wurde. Eine ihrer Messen scheint 1761 in der Kirche St. Michael, die von der Familie Martines besucht wurde, gespielt worden zu sein. Martines‘ Biograph Irving Godt ist aber „ziemlich sicher […], dass die gesungene Messe ihre Terza Messa in C war“, die sie einen Monat zuvor vollendet hatte. Es ist nicht verwunderlich, dass die junge Komponistin schnell von der kompakten Seconda Messa zu einem so ambitionierten Werk wie der Terza überging und sich für letztere entschied, als sich eine Gelegenheit zur Aufführung ergab. Nichtsdestotrotz ist die Seconda Messa ein Juwel in Marianna von Martines‘ Oeuvre und verdient es, neben den frühen Werken ihrer (noch) bekannteren Zeitgenossen ihren Platz im heutigen Aufführungsrepertoire einzunehmen!

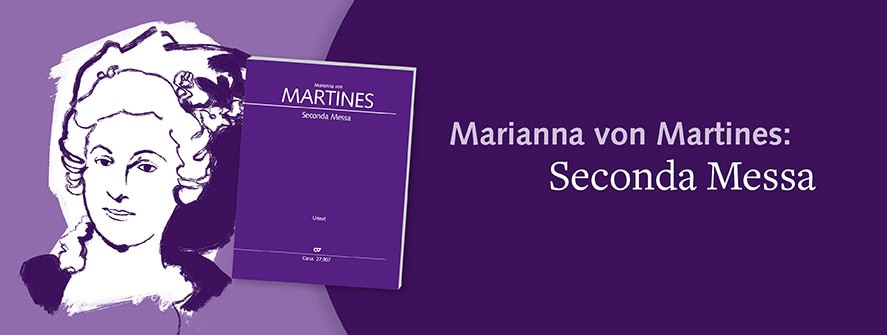




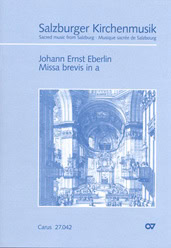 Die Missa a-Moll lässt die Charakteristika des von Eberlin ausgeprägten Typus der Missa brevis klar erkennen. Die Besetzung ist reduziert auf Soli, vierstimmigen Chor und das Salzburger Kirchentrio mit zwei Violinen und Basso continuo. Als Spezifikum der Aufführungspraxis im Salzburger Dom treten noch drei Posaunen hinzu, die in den chorischen Teilen mit Alt, Tenor und Bass colla parte spielen und in den Solopassagen pausieren. Der von Eberlin ausgeprägte Typus der Missa brevis gab W. A. Mozart das Vorbild für die formale Gestaltung seiner Messen dieses Gattungsbereiches.
Die Missa a-Moll lässt die Charakteristika des von Eberlin ausgeprägten Typus der Missa brevis klar erkennen. Die Besetzung ist reduziert auf Soli, vierstimmigen Chor und das Salzburger Kirchentrio mit zwei Violinen und Basso continuo. Als Spezifikum der Aufführungspraxis im Salzburger Dom treten noch drei Posaunen hinzu, die in den chorischen Teilen mit Alt, Tenor und Bass colla parte spielen und in den Solopassagen pausieren. Der von Eberlin ausgeprägte Typus der Missa brevis gab W. A. Mozart das Vorbild für die formale Gestaltung seiner Messen dieses Gattungsbereiches. Die Missa Beatissimae Virginis Mariae entstand etwa 1758–1760. Als Frühwerk steht die Messe einerseits in jener festlich-barocken Stiltradition, wie sie im süddeutschen Raum bis zur Jahrhundertmitte die Norm der kirchenmusikalischen Praxis darstellte; andererseits zeigt sie bereits subjektive Inspiration, wodurch sich das Werk von vielen Messvertonungen der Zeitgenossen abhebt.
Die Missa Beatissimae Virginis Mariae entstand etwa 1758–1760. Als Frühwerk steht die Messe einerseits in jener festlich-barocken Stiltradition, wie sie im süddeutschen Raum bis zur Jahrhundertmitte die Norm der kirchenmusikalischen Praxis darstellte; andererseits zeigt sie bereits subjektive Inspiration, wodurch sich das Werk von vielen Messvertonungen der Zeitgenossen abhebt.


Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!