Pablo Casals: El Pessebre (Weihnachtsoratorium)
Ein musikalisches Mahnmal für Frieden und Humanität
Die Musikgeschichte ist reich an Werken, die eine tiefe humanistische Botschaft tragen. Ein solches Werk ist „El Pessebre“, das Weihnachtsoratorium von Pablo Casals. Entstanden unter dem Eindruck des Spanischen Bürgerkriegs und des Zweiten Weltkriegs, wurde es zum Symbol für Frieden und Menschlichkeit.
Pablo Casals: Ein Leben im Zeichen der Musik und des Widerstands
Pablo (Pau) Casals (1876–1973) war ein herausragender Cellist seiner Zeit, ein visionärer Musiker und engagierter Humanist. Geboren in Katalonien, erhielt er bereits in früher Kindheit eine umfassende musikalische Ausbildung. Als Virtuose revolutionierte er das Cellospiel durch innovative technische Ansätze und prägte als Pädagoge eine ganze Generation von Cellist*innen. Seine Weltkarriere als Cellist und Dirigent führte ihn mit zahlreichen bedeutenden Künstlern seiner Epoche zusammen. Neben seiner Tätigkeit als Interpret komponierte Casals Werke für Orchester, Konzerte, Lieder, Kammermusik sowie geistliche Chormusik. Viele seiner Kompositionen blieben unveröffentlicht. Zu Lebzeiten erschienen vor allem seine kirchenmusikalischen Werke.
Die Entstehung von El Pessebre
Doch Casals war nicht nur ein außergewöhnlicher Musiker, sondern auch ein Mann mit tiefen moralischen Überzeugungen. Der Spanische Bürgerkrieg und die anschließende Franco-Diktatur zwangen ihn ins Exil.
Seinen Zufluchtsort fand Pablo Casals in Prades/Südfrankreich, am Fuße der Pyrenäen. Dort wurde 1939 der katalanische Politiker, Schriftsteller und Übersetzer Joan Alavedra zusammen mit seiner Familie sein Hausgenosse. In dem spärlichen Gepäck, das Alavedra bei der Flucht im Januar über die Pyrenäen verblieben war, befand sich der Anfang eines Krippengedichts, das Alavedra noch in Barcelona für seine 5-jährige Tochter begonnen hatte. Das Kind hatte den Vater zu Weihnachten gebeten, nicht nur eine Krippe mit vielen Figuren aufzustellen, sondern auch ein Gedicht zu schreiben: Sie wollte wissen, was die Krippenfiguren alles zu erzählen haben. Inspiriert von der kindlichen Unschuld und Reinheit der Weihnachtsgeschichte schrieb Alavedra das Gedicht als eine tiefgründige Reflexion über Leid, Hoffnung und Menschlichkeit.
Nach der Besetzung Südfrankreichs durch die deutschen Truppen lebten Casals und die Familie Alavedra als Gegner Francos in ständiger Angst vor Hausdurchsuchungen, Verhören und Repressalien durch die deutsche Besatzungsmacht. Trotz dieser angespannten Lage konnten 1943 in Perpignan die „Jocs Florals“ (Blumenspiele) stattfinden, ein traditionsreicher Wettbewerb für katalonische Dichtung. Alavedra vollendete sein „Poema del Pessebre“ („Krippengedicht“) und gewann damit einen ersten Preis, „La Flor Natural“. Beeindruckt von der Kraft der Verse, begann Casals sofort mit der Vertonung des Gedichts. Kennt man diese Vorgeschichte, versteht man, weshalb Alavedras „Poema del Pessebre“ weit über eine jubelnd-frohe Weihnachtsbotschaft hinausgeht. Immer wieder durchbrechen nachdenklich stimmende Szenen den festlichen Ton und erinnern an Christi Martertod sowie die Vergänglichkeit der Welt.
Pablo Casals am Cello
fotografiert von Ferdinand Schmutzer
(1870–1928)
Blick auf die Ortschaft Prades
(Pyrénées-Orientales)
Pablo Casals
El Pessebre (Die Krippe)
Carus 7.333/00
Pablo Casals
El Pessebre (Die Krippe)
Bearbeitung (reduzierte Orchesterbesetzung)
von Antoni Ros Marbà
Carus 7.333/50
Aufbau und Instrumentierung
El Pessebre ist ein zweistündiges Oratorium für Soli (Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass), Chor und Orchester. Zusätzlich zum Originaltext von Joan Alavedra gibt es eine englische Version von Marta Casals Istomin sowie eine deutsche Version von Helga W. Pfeiffer. Herausgeber der revidierten Fassung ist Rudolf von Tobel, ein ehemaliger Schüler und Assistent von Casals, der selbst unter dessen Leitung El Pessebre aufgeführt hat.
Das groß angelegte Oratorium ist in mehrere Abschnitte gegliedert:
- Prolog: Präludium und die „Verkündigung an die Hirten“
- Teil I: Auf dem Wege nach Bethlehem. Szenen wie „Der Mann am Brunnen“ oder „Das Paar bei der Weinlese“ zeichnen das Bild einer Welt, die auf die Ankunft des Heilands wartet.
- Teil II: Die Karawane der Weisen aus dem Morgenland. Musikalisch wird die Reise der Sterndeuter dargestellt, unter anderem mit dem „Chor der Kamele“ und dem „Chor der drei Weisen“.
- Teil III: Die Krippe. In den zentralen Szenen des Werks, die durch ein Intermezzo eingeleitet werden, rücken Maria, Josef, das Jesuskind, aber auch der Ochs und Esel in den Fokus.
- Teil IV: Die Anbetung. Im Mittelpunkt stehen die Heilige Nacht, die Ankunft der Hirten und die Gaben der Könige und Hirten. Das Oratorium endet mit einem feierlichen Hosanna und Gloria.
Die Musik von Casals ist in einer pastoralen, eingänglichen Tonsprache gehalten und stark von liedhaften Elementen geprägt. Das Werk entfaltet mit großem Chor, Vokalsolist*innen und einem sinfonischen Orchester eine imposante Klangfülle. Die Originalfassung sieht eine spätromantische, großbesetzte Instrumentierung vor (angefertigt von Casals‘ Bruder Enrique Casals), die dem Werk eine monumentale symphonische Dimension verleiht.
Die Orchesterbesetzung:
- Holzbläser: 3 Flöten (auch Piccoloflöte), 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott
- Blechbläser: 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba
- Schlagwerk: 3 Pauken, große Trommel (Gran cassa), kleine katalanische Trommel (Tamborí), Tam-Tam, Tamburino, Becken (Piatti), Glockenspiel (Campanelli), Triangel, Kastagnetten, 3 Glocken (Campane)
- Harfe, Celesta
- Streicher: 1. Violinen (14), 2. Violinen (12), Bratschen (10), Violoncelli (8–10), Kontrabässe (6–7)
Verschiedene aufführungspraktische Fassungen des Werks
Aufgrund der umfangreichen Originalbesetzung erschien El Pessebre bei Carus in mehreren reduzierten Fassungen. Klavierauszüge und Chorpartituren der Originalfassung sind mit allen Versionen kompatibel.
- Originalfassung mit Instrumentierung von Enrique Casals (Carus 7.333/00).
- Bearbeitung für reduziertes Orchester von Antoni Ros Marbà (Carus 7.333/50), mit einer optionalen Kürzung von 120 auf 90 Minuten. Im Vergleich zur Originalversion entfallen hier 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 1 Trompete, und die Celesta ist ad libitum.
- Fassung für Soli, Chor und Orgel von Klaus Rothaupt (Carus 7.333/45). Auf Wunsch von Marta Casals-Istomin, der Ehefrau von Pablo Casals, fertigte Klaus Rothaupt 2006 eine Orgelversion an, die Aufführungen mit fünf Vokalsolist*innen, Chor und Orgel ermöglicht. Die Orgelpartie ist für eine gut besetzte, zweimanualige Orgel mit Schwellwerk konzipiert.
Ein Weihnachtsoratorium mit universeller Botschaft
El Pessebre erzählt die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive der Krippenfiguren – doch es ist weit mehr als eine bloße Schilderung der Geburt Christi. Pablo Casals verbindet die religiöse Tradition mit einem kraftvollen humanistischen Appell. Die Worte gehen weit über das Geschehen der Heiligen Nacht hinaus und nehmen die gesamte christliche Erlösungsgeschichte in den Blick.
Ursprünglich wollte Casals das Werk nach dem Krieg und der Befreiung Spaniens vom Franco-Regime in seiner Heimat uraufführen. Doch da die Diktatur fortbestand, ergab sich erst 1960 die Gelegenheit zur Uraufführung in Mexiko, das zu der Zeit besonders viele katalanische Flüchtlinge aufgenommen hatte. Auf Bitten von Casals ergänzte Alavedra das Werk um eine Anbetungsszene, die der Komponist in seinem Exil in Puerto Rico vertonte.
Bis zu seinem Tod dirigierte Casals das Werk mehr als vierzig Mal. Die Botschaft lag ihm zutiefst am Herzen: In einer Welt, die von Kriegen und Ungerechtigkeit gezeichnet war, wollte er mit seiner Musik ein Zeichen für Frieden und Menschlichkeit setzen.
Bis heute bleibt das Oratorium ein bewegendes Mahnmal für Frieden – und ein eindrucksvolles Beispiel dafür, welche Kraft die Musik besitzt, um Menschen zu vereinen und Hoffnung zu schenken.
Lorenz Adamer studierte an den Universitäten Wien (AT), Cremona/Pavia (ITA) und Tübingen Musikwissenschaft und Philosophie. Seit dem Sommer 2017 arbeitet er im Carus-Verlag, zuerst als Vertriebsassistenz und mittlerweile als Redakteur im Lektorat. In seiner Freizeit spielt er leidenschaftlich Klarinette und singt gerne im Chor.




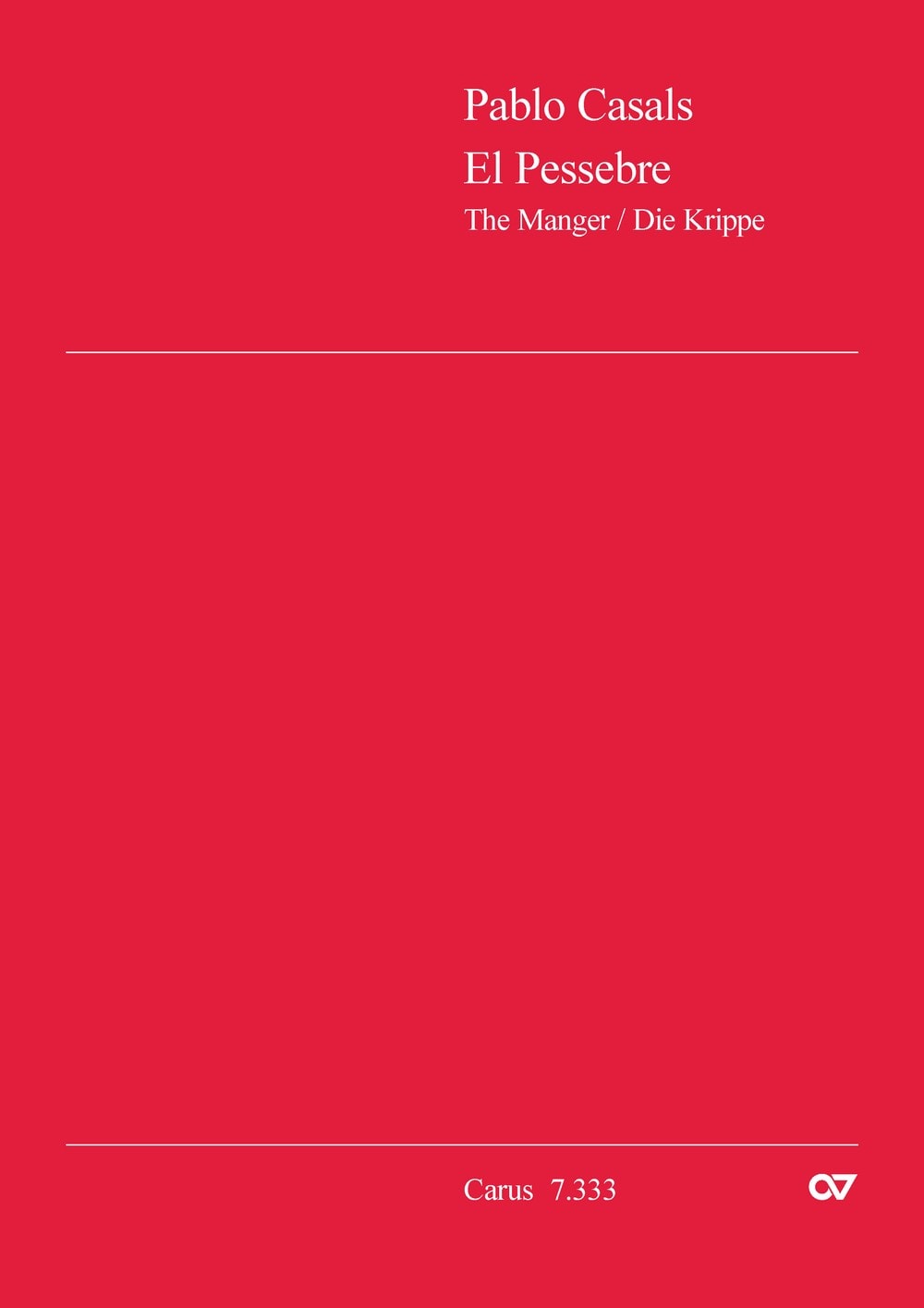
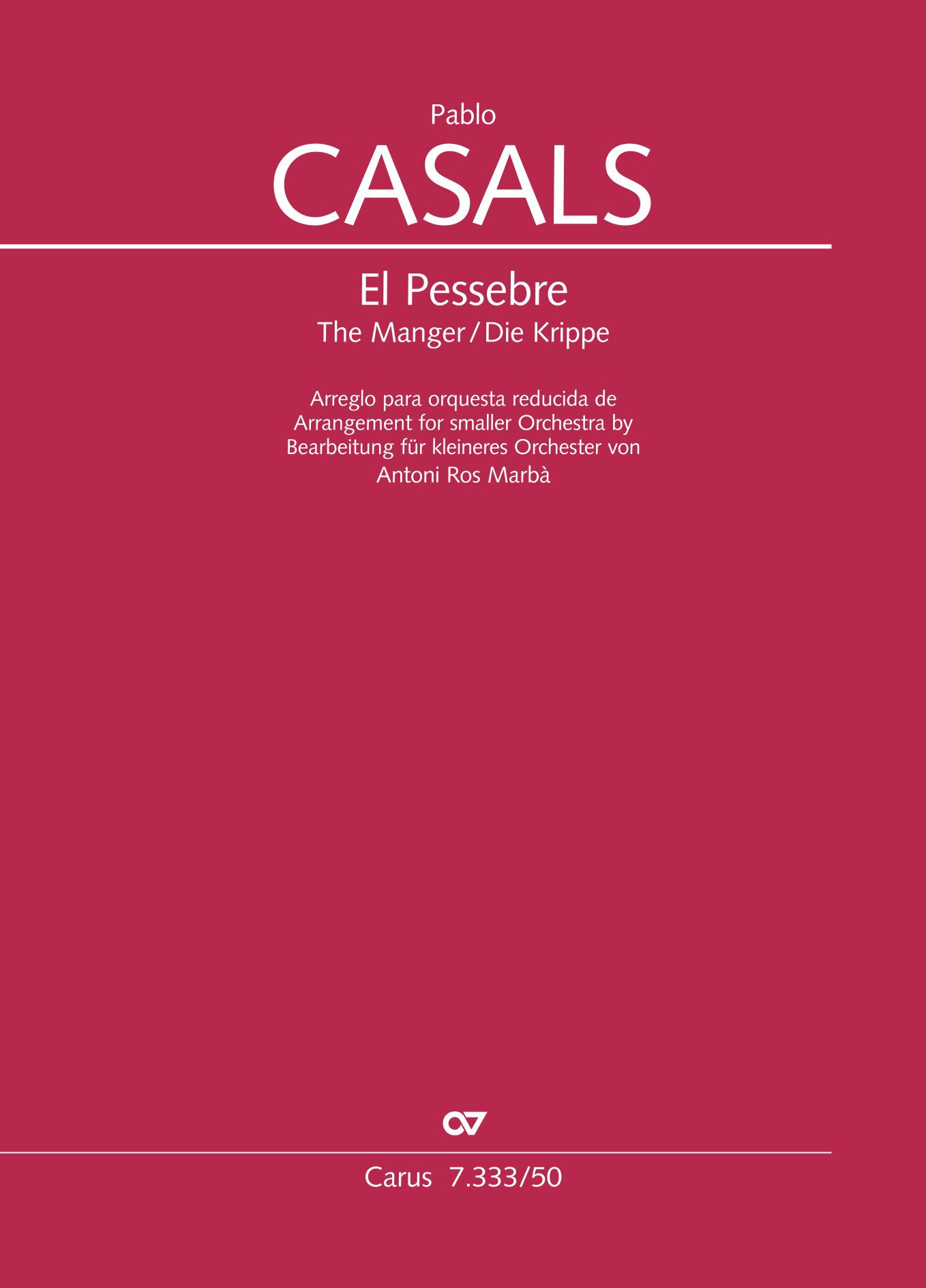
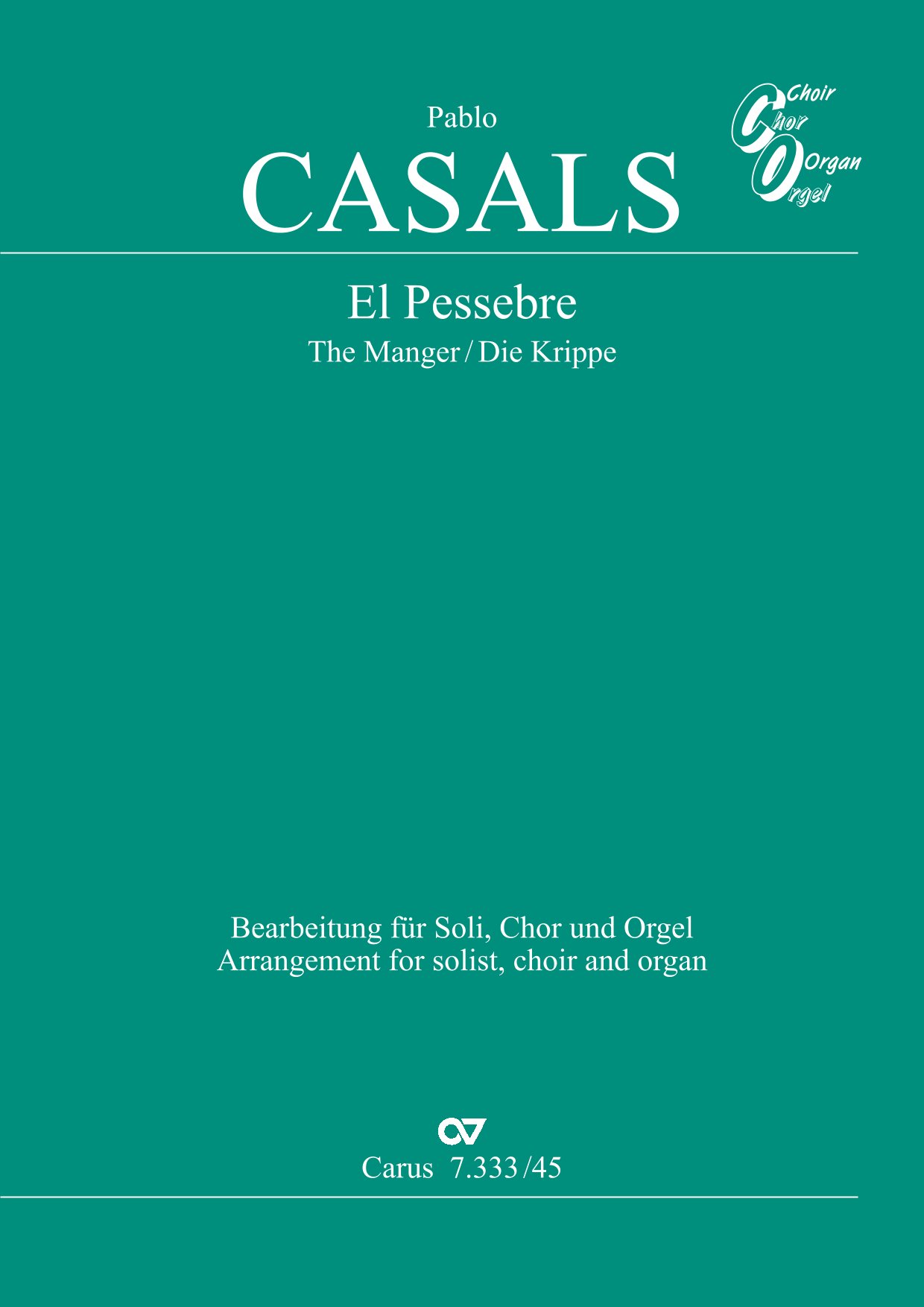

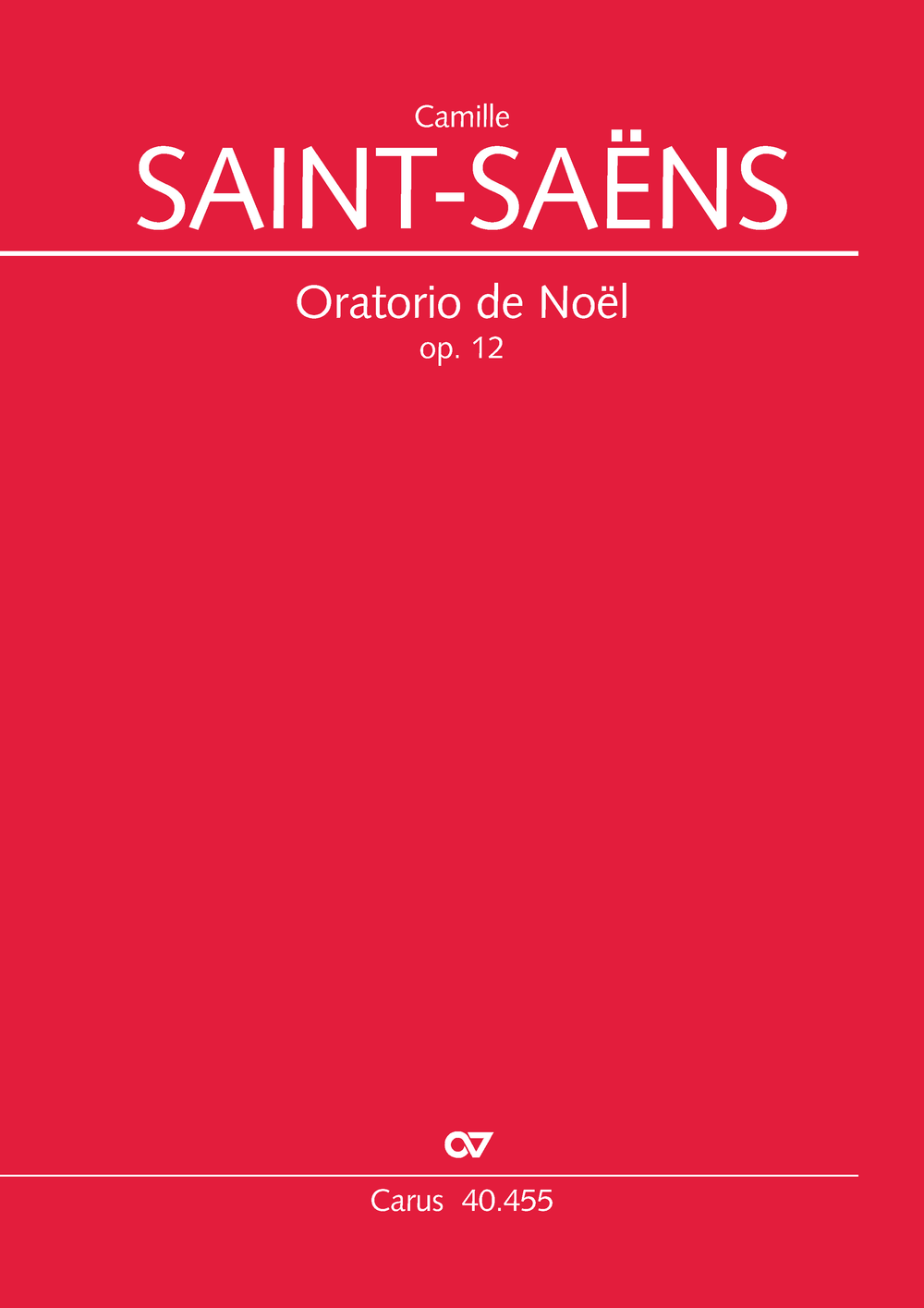 Camille Saint-Saëns komponierte sein Oratorio de Noël für fünf Vokalsoli, gemischten Chor, Streicher, Orgel und Harfe im Jahr 1858. Dem Werk in lateinischer Sprache liegen Texte des Alten und Neuen Testamentes, der Evangelien, Psalmen und der katholischen Weihnachtsliturgie zugrunde. Eine kammermusikalische Instrumentierung, lyrisch gehaltene solistische Partien und ein schlicht geführter Chor verbinden sich zu einer pastoralen Grundstimmung und lassen dieses Weihnachtsoratorium zu einem der meist aufgeführten Werke des Komponisten werden.
Camille Saint-Saëns komponierte sein Oratorio de Noël für fünf Vokalsoli, gemischten Chor, Streicher, Orgel und Harfe im Jahr 1858. Dem Werk in lateinischer Sprache liegen Texte des Alten und Neuen Testamentes, der Evangelien, Psalmen und der katholischen Weihnachtsliturgie zugrunde. Eine kammermusikalische Instrumentierung, lyrisch gehaltene solistische Partien und ein schlicht geführter Chor verbinden sich zu einer pastoralen Grundstimmung und lassen dieses Weihnachtsoratorium zu einem der meist aufgeführten Werke des Komponisten werden.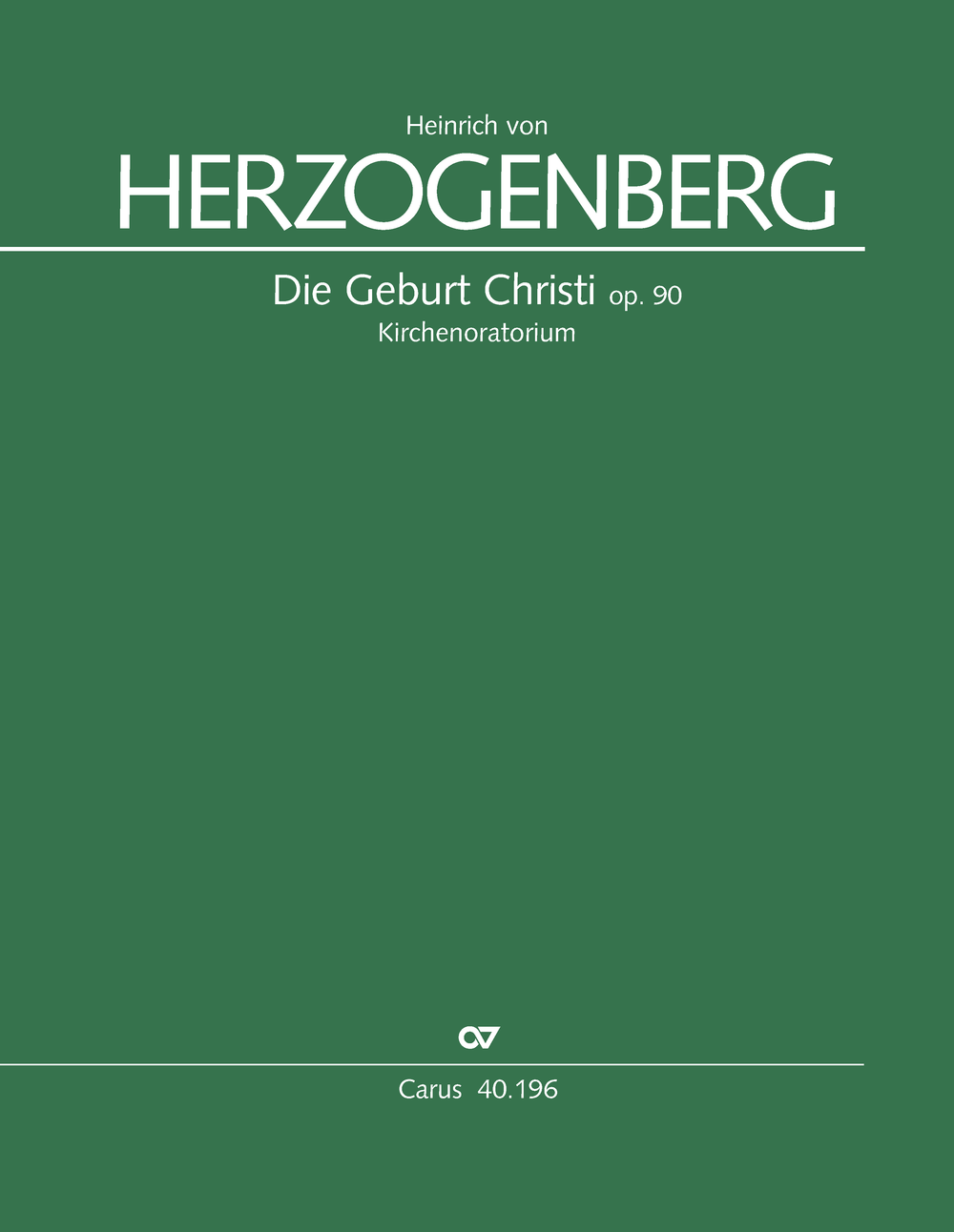



Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!