Musiktheater von Ludger Vollmer
Paul und Paula oder die Legende vom Glück ohne Ende
Liebe, Leidenschaft und Schicksal: Ulrich Plenzdorfs Paul und Paula ist eine der großen Liebesgeschichten der 1970er. Die Geschichte, die Millionen im Kino bewegte, wird auf der Opernbühne neu interpretiert. Ludger Vollmer wagt einen kühnen Schritt und verbindet die bekannte Erzählung mit einer faszinierenden musikalischen Welt, die zwischen Tradition und Moderne changiert.
Ein Opernstoff vom Feinsten
Es ist eine der schönsten Liebesgeschichten der 1970er Jahre: Ulrich Plenzdorfs Roman Paul und Paula oder Die Legende vom Glück ohne Ende. Vor allem in der früheren DDR erreichte die Geschichte durch Heiner Carows Kinofilm Paul und Paula einen hohen Bekanntheitsgrad, der Film war bis in die 2000er Jahre in einzelnen Berliner Programmkinos zu sehen. Die ergreifende Liebesgeschichte um den angepassten Paul und die unkonventionelle Paula bildet den Stoff der gleichnamigen Oper von Ludger Vollmer. Mit seinem Opernerstling betrat der Komponist, der sich durch sehr alte (modale) europäische bzw. durch außereuropäische Kompositionstechniken inspirieren ließ, dramaturgisch und musikalisch unberührtes Terrain. Sein Musiktheaterstück, grundsprachlich mit stark melodisch-rhythmischem Gestus, ist im Zwischenbereich von Oper und Musical angesiedelt und enthält auch Elemente aus der Rap-, HipHop- und Rockmusik. Es geht über den Kinofilm von Carow, in dem aus zeitpolitischen Gründen nur der erste Teil des Romans aufgenommen wurde, hinaus und führt die Handlung im zweiten Teil bis zum Verschwinden Pauls fort.
Die Handlung
Paul, verheiratet, begabter und angepasster Mitarbeiter des Geheimdienstes, trifft während einer Lebenskrise auf die unangepasste, lebensfrohe Paula, eine ungelernte Arbeiterin und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern verschiedener Väter. Die Liebe zu Paula führt Paul in Konflikte mit seiner durch die „Dienststelle“ geprägten Lebensform. Paulas Anziehungskraft wird so stark, dass Paul aus seinem bisherigen Lebensraster ausbricht und auf die Seite der Non-Konformen wechselt. Nach dem Tod Paulas versucht die „Dienststelle“ durch den Einsatz von Laura (als Double von Paula), Paul in sein Dienstverhältnis und seine alte Lebensform zurückzuholen. Der Unfall Pauls, der zur Querschnittslähmung führt, hat letztendlich den völligen Ausbruch aus dem alten Beziehungsgeflecht zur Folge.
Das Thema
Thema von Paul und Paula oder Die Legende vom Glück ohne Ende ist die Entwicklung des Menschen vom systemangepassten und sozial kontrollierten Objekt zum authentischen Subjekt seines Lebens. Haupttriebfeder dieser Entwicklung ist die unmittelbare, unbestechliche Liebe, die in Plenzdorfs Roman in zwei Ergebnisse mündet: die vollkommene und konsequente Selbstverwirklichung (Tod Paulas) und der Weg des begabten, voll angepassten und karrierehörigen Durchschnittsmenschen (Paul) hin zu einer eigenen Persönlichkeit und letztendlich zur vollständigen Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen. Dieses Thema wird anhand der Lebenssituation von Menschen entwickelt, die unter dem Fokus eines Geheimdienstes stehen. Dieser versucht, die vollkommene Kontrolle über den Menschen zu erlangen, indem er in den Raum einzudringen versucht, der den Kern des Menschen ausmacht: den Raum der Liebe.
Bei der Auswahl des Stoffes war Vollmer vor allem der psychosoziale Konflikt hinter dem politischen Kontext wichtig, der im Gegensatz zu Ort und Zeit des Geschehens (Ost-Berlin, 1970er Jahre) außerordentlich aktuell und psychologisch hochbrisant ist. Dies betrifft Paul und Paula ebenso wie etwa Puccinis Politkrimi Tosca oder Verdis Rigoletto, die mehr als 100 Jahre nach ihrem Entstehen den Menschen heute noch sehr viel an psychologischer Erkenntnis zu geben vermögen, obwohl ihr politischer Kontext längst nicht mehr gegenwärtig ist. Um dem schnell sich erhebenden Verdacht zu begegnen, dass die Oper als Film-Revival von Paul und Paula konzipiert ist, muss betont werden, dass es sich bei Vollmers Paul und Paula um eine Oper mit einer völlig neuen, stark auf unsere Zeit Bezug nehmenden Emotionalität, Form und Klangsprache handelt. Sie benutzt Klangsymbole und provoziert Sinneswahrnehmungen, die zumindest künstlerisch gesehen in der Zeit des Filmes gar nicht existierten.
Text und Dramaturgie
In textlicher Hinsicht hat sich Vollmer sehr eng an den Originaltext von Plenzdorf gehalten, wobei er an Stellen, die Prosa erforderten, die Stimmung der Texte Plenzdorfs in eigene Worte gefasst hat. Die Texte zu den zentralen Liebesszenen zwischen Paul und Paula stammen von Walther von der Vogelweide. Bei der dramaturgischen Gestaltung greift er auf die Tradition der Troubadours zurück, indem sogenannte „scènes des troubadours“ eingebaut werden, welche die Handlung vorwärtstreiben – eine Idee, die in Plenzdorfs Roman schon durch meine Person, eine Rentnerin, angelegt ist. Die Handlung wird in relativ kurzen, rasch aufeinander folgenden Szenen entwickelt, wobei der Chor wichtige Punkte der Handlung markiert.
Uraufführung
Die Oper Paul und Paula richtet sich an ein breites Publikum, das sich für Oper, Musical und zeitgenössische Musik interessiert. Sie ist sowohl für Kenner der Vorlage als auch für Zuschauer, die sich zum ersten Mal mit der Geschichte auseinandersetzen, zugänglich. Die Uraufführung von Paul und Paula oder Die Legende vom Glück ohne Ende fand am 9. April 2004 am Theater Nordhausen statt. Regie führte die ungarische Regisseurin Dorotty Szalma (*1974), die sowohl mit Musik- als auch Sprechtheaterproduktionen deutsche und ungarische Häuser füllt. Die musikalische Leitung hatte Stephan Ottersbach. Die Rezeption der Oper war durchweg positiv. Kritiker lobten vor allem die musikalische Qualität, die intensive Darstellung der Charaktere und die Aktualität der Thematik.
Ludger Vollmer ist seit 1993 freischaffender Komponist und Musiker. Nach Studien in Viola und Komposition in Weimar und Leipzig wurde er mit internationalen Preisen wie dem Europäischen Toleranzpreis ausgezeichnet.
„Als Komponist kann ich mit der Oper definitiv am meisten ausrichten. Die Oper ist im Aufwind. Es gibt keinen Ort, der durch sie nicht berührt wird.“
Alle aktuellen Infos zu Person und Werk finden Sie auf https://ludger-vollmer.de/
Pressestimmen
Mit gutem Grund also hat Vollmer sich nicht auf das „Paul und Paula“-Melodram beschränkt und den stilistischen Fächer seiner Musik weit geöffnet: ein Genremix, der Kombination aus Gefühlsarchäologie und schnittbedingter Filmdramaturgie entschieden angemessen. Wobei er selbst Musical-Buntscheckigkeit nicht verschmäht. Puccineskes Melos, Schostakowitsch-Groteske, Weill-Eisler-Songs, allerlei Jazz-Spritzer, Rock, Rap und Raga, auch afrikanische Rhythmusraster wechseln kaleidoskopisch rasch ab. Fast ohrwurmartig einprägsam tönt manches, doch Vollmer ist klug genug, nicht allzu billig dem Affen Zucker zu geben. Im ersten Teil ist seine Musik nicht unbedingt wählerisch, im zweiten, auf den Schmerzensmann Paul konzentriert, wird sie dunkel-kompakter, dringlicher.
(Gerhard R. Koch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. April 2004)
In Nordhausen zeigte sich auch Autor Ulrich Plenzdorf begeistert von der Veroperung seines Romans.
(Leipziger Volkszeitung, 13. April 2004)

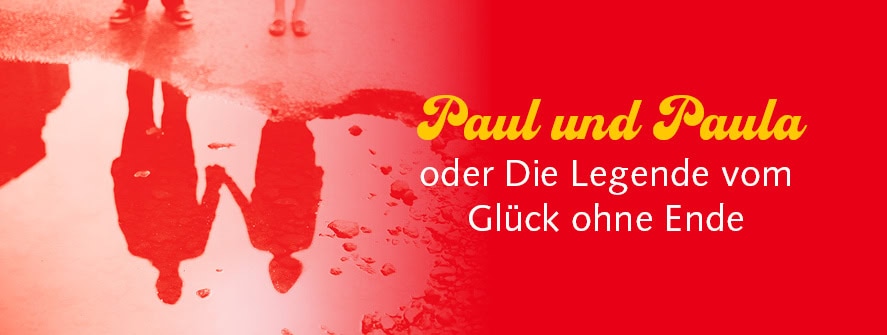
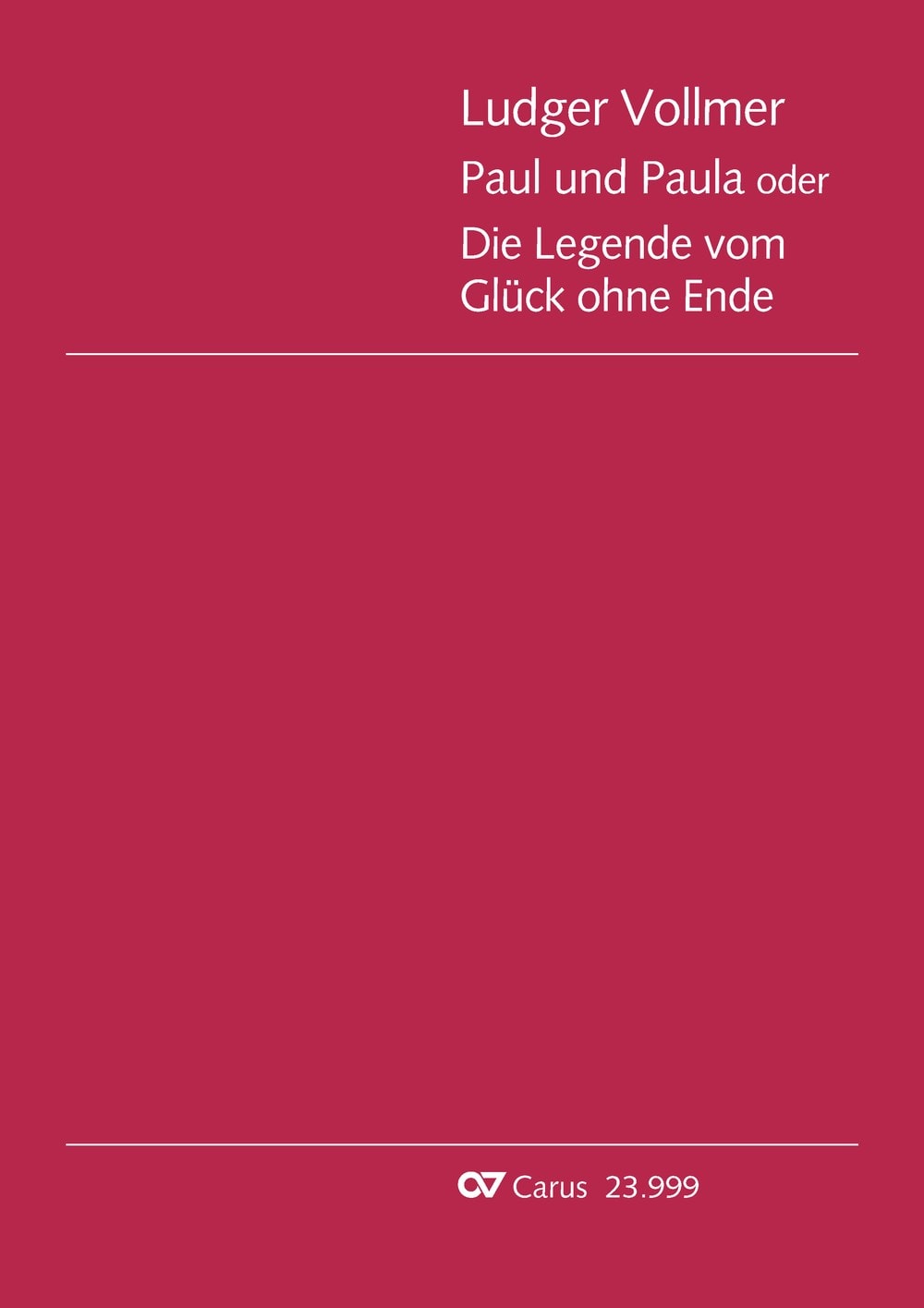



Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!