Georg Philipp Telemanns „Donner-Ode“ und „Die Tageszeiten“
Tönende Natur
Am 1. November 1755 wird die Welt von einem gewaltigen Beben erschüttert, und kein Stein bleibt mehr auf dem anderen: Das Erdbeben von Lissabon – ein gewaltiger Tsunami, wie wir heute wissen – zerstört nahezu komplett die viertgrößte Metropole Europas, tötet über 100.000 Menschen und bringt auch große Teile des gedanklichen Fundaments der Aufklärung ins Wanken. Diese Naturkatastrophe ist ein einschneidendes Ereignis, das einen geistesgeschichtlichen Epochenumbruch einleitet. Nach ihr ändert sich entscheidend das theologische und philosophische Denken der Epoche, es bröckeln geistige (und geistliche) Gewissheiten, der mündige, tätige Mensch erweist sich auf einmal als ein Spielball unkontrollierbarer Naturgewalten. Die Zeitgenossen suchen nach Erklärungen, vor allem stellen sie sich nun verstört die Frage, wie solch eine Katastrophe mit der „besten aller möglichen Welten“ (Leibniz) eines gütigen Gottes überhaupt vereinbar sei.
Das Erdbeben von Lissabon ließ natürlich auch die zeitgenössischen Künste nicht unbeeinflusst. In der Musik entwickelt sich die bis dato als „Geräusch“ und „zu keiner eigenständigen Aussage fähig“ abqualifizierte Instrumentalmusik mehr und mehr zu einem gleichberechtigten, aussagekräftigen Partner der textgebundenen (und ihr früher stets vorgezogenen) Vokalmusik. Sicherlich spielte dabei die Fähigkeit der textlosen Musik, Naturgeräusche nachzuahmen und Naturphänomene bildhaft darzustellen eine große Rolle.
Georg Philipp Telemann hat diese Entwicklung maßgeblich geprägt. Gerade sein eindrucksvolles Spätwerk aus den 1750er und 1760er Jahren steht für einen Aufbruch zu neuen Ufern. Mit der Donner-Ode von 1756 reagiert Telemann direkt auf das Erdbeben von Lissabon. Telemann wählt als Text eine enthusiastische Dichtung, die Christian Gottfried Krause (1719–1770) und Karl Wilhelm Ramler (1725–1798) aus den Psalmen 8 und 29 (durch den Kopenhagener Hofprediger und Poeten Johann Andreas Cramer ins Deutsche übersetzt und in Verse gebracht) zusammengestellt hatten. Dieser freien Erlebnisdichtung (man könnte auch von einem Gesang in höchster Erregung sprechen) begegnet der Komponist mit individuellen musikalischen Verläufen, in denen die Form unmittelbar aus der jeweiligen Handlung zu entstehen scheint.
Der feierliche Eingangschor „Wie ist dein Name so groß“ formuliert die Kernaussage des gesamten Stücks: den „Lobpreis Gottes angesichts der Erhabenheit der gewaltigen Natur“ (Laurenz Lütteken). Unter dem „Erhabenen“ versteht man im 18. Jahrhundert das „große und furchtbar Schöne in der Natur“ (Klopstock); der Kreis um Johann Andreas Cramer spricht sogar von einem „angenehmen Grauen“. „Erhaben“ und prachtvoll ist auch dieser Eingangschor. Sein gravitätischer, punktierter Rhythmus zu Beginn erinnert ebenso an die Ouvertüre einer Suite wie seine anfängliche Dreiteiligkeit, mit schnellem, nicht-punktiertem Mittelteil („von deinem Namen entzücket“) und der Wiederkehr des Anfangs.
In den folgenden Sätzen ignoriert Telemann weiterhin die traditionellen Formen geistlicher Vokalmusik, weder gibt es Rezitative noch klassische Arien. Vielmehr folgen solistische Monologe in freier Form aufeinander, die meistens mit konzertierenden Instrumenten aufwarten: Sopran und Fagott im zweiten, Alt und Oboe d’amore im dritten, Tenor und virtuose Streicher im vierten, erster Bass und Horn im fünften, zweiter Bass und Trompete im sechsten sowie beide Bässe und Pauken im siebten Satz.
Georg Philipp Telemann
Donner-Ode
Die Neuausgabe berücksichtigt erstmals wichtige, neu aufgefundene Quellen wie das Autograph des ersten Werkteils.
Von Satz zu Satz steigt die Dramatik, spitzt sich die Odenhandlung zu. Zum ersten Mal werden die tobenden Naturgewalten im mit „feurig“ überschriebenen Monolog des Tenors beschrieben: „Die Stimme Gottes erschüttert die Meere“. Rasende Rhythmen in den Geigen und Koloraturen in der Stimme erzeugen eine bildhafte Virtuosität, die den Donner auf der Zeile „Der Höchste donnert“ imitiert. Aktualität stellt sich ein, die Katastrophe von Lissabon erscheint vor dem geistigen Auge. Im sechsten Satz geht die Zerstörung durch die Gewalt der Natur, in der sich die Herrlichkeit Gottes äußert, noch einen Schritt weiter – Gebirge stürzen zusammen, und „der Erdkreis wankt“. Beides findet seine Entsprechung in der Musik, die Geigen prägen im hektischen Zickzack bildhaft eine Gebirgskette aus, die Trompete tönt dazwischen wie die letzte Posaune des Jüngsten Gerichts, und der Bass bringt mit gesungenen Synkopen den Rhythmus ins Wanken.
Das Schlussduett des 1. Teils, an den sich das Da Capo des Eingangschors anschließt, ist Höhepunkt und rhetorisches Fazit der gesamten Donner-Ode: „Er donnert, dass er verherrlichet werde.“ Telemann geht es hier nicht um ein Duett im üblichen Sinne, sondern um ein verstärktes Singen, wobei der durch Triller und Tonrepetitionen symbolisierte Donner beide Gesangsstimmen wie Instrumente behandelt. Die unkonventionelle Solopauke verstärkt den Eindruck einer albtraumhaften Höllenfahrt – und mündet in der Forderung nach einem Lobgesang, die organisch das Da Capo des Eingangschors nach sich zieht. Damit schließt sich der Kreis, am Anfang wie am Ende steht das Lob der Herrlichkeit Gottes. Der zweite Teil der Donner-Ode entsteht zum Neujahrstag 1760. Uraufgeführt wird „Mein Herz ist voll“ ebenfalls in der Hamburger Hauptkirche St. Katharinen, und zwar als Musik vor der Predigt.
Der kriegerisch anmutende Text stammt auch aus Cramers Psalmenübersetzung. Der Bearbeiter des Textes ist nicht belegt, man nimmt aber an, dass Telemann selbst den Psalm 45 für seine Zwecke bearbeitet hat. In einem denkwürdigen Konzert am 8. April 1761 im Hamburger Drillhaus, dem üblichen Veranstaltungsort für Telemanns eigene Konzertreihe, erklingt die Donner-Ode erneut. Georg Philipp Telemann kombiniert sie mit zwei weiteren Spätwerken, der Auferstehung und den Tageszeiten. Gerade die 1759 entstandenen Tageszeiten entfernen sich mit ihrer individuellen Musiksprache zunehmend vom Barock und liegen näher beim galanten Stil des jungen Joseph Haydn (man höre sich nur dessen drei „Tageszeiten“-Sinfonien von 1761 an!). Auf eine einleitende Symphonie im italienischen Stil à la Vivaldi, die musikalisch das Bild des anbrechenden Tages (ansteigende Melodie = Sonnenaufgang) evoziert, folgen vier Kantaten (Der Tag, Der Mittag, Der Abend, Die Nacht), die stimmungsvoll und bildhaft die Natur und die Atmosphäre der einzelnen Tageszeiten schildern. Jede von ihnen ist gleich strukturiert, mit der Abfolge Arie – Rezitativ – Arie – Chor, trotzdem wirkt jede für sich wie eine freie Meditation über ein Thema, in der stets eine Solostimme mit einem konzertierenden Instrument (Morgen: Sopran & Trompete, Mittag: Alt & Viola da Gamba, Abend: Tenor & 2 Traversflöten, Nacht: Bass & Fagott) zu Wort kommt.
Friedrich Wilhelm Zachariae, der damals dreißigjährige Textdichter der Tageszeiten, schwärmte von dem achtundsechzigjährigen Telemann, der in seinem Spätwerk so empfindsame, bildhafte und unkonventionelle Musik zu komponieren wusste: „Aber wer ist der Greis, der mit leichter Feder, voll vom heiligen Feuer, den staunenden Tempel entzücket? Höre! wie rauschen die Wogen des Meers; wie jauchzen die Berge und das Land des Herrn! […] Telemann, niemand als du, du Vater der heiligen Tonkunst…“
Dr. Henning Bey arbeitet seit Oktober 2025 als Promotion Manager Bühne und Orchester beim Carus-Verlag. Vorher war er Künstlerischer Planer beim SWR Symphonieorchester, Chefdramaturg der Internationalen Bachakademie Stuttgart und Dramaturg beim Freiburger Barockorchester. Editionserfahrung sammelte er als Mitarbeiter der Neuen Mozart-Ausgabe in Salzburg.






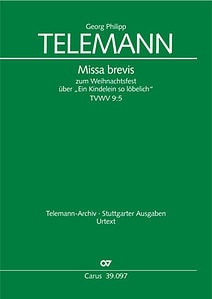


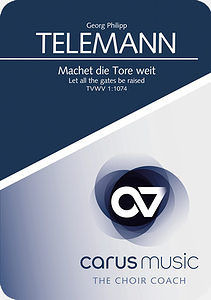

 © Mirjam Hagen
© Mirjam Hagen
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!