Der Reiz der Fragmente
Über Rekonstruktionen von Bach-Kantaten
Wie geht man mit Material um, bei dem sowohl Partituren als auch Stimmen fehlen oder nur bruchstückhaft erhalten sind? Anhand dreier faszinierende Kantaten von Johann Sebastian Bach zeigt Cheflektor Dr. Uwe Wolf, wie Musikwissenschaftler*innen und Interpret*innen durch akribische Rekonstruktionen verlorene oder unvollständige Meisterwerke wieder zum Leben erwecken. Lassen Sie sich von den detektivischen Hintergrundgeschichten begeistern und entdecken Sie die spannenden Rätsel, die uns diese Musikfragmente bis heute aufgeben.
Die fragmentarische Überlieferung spielt in der Kunst seit jeher eine große Rolle. Während man ein Werk der bildenden Kunst – etwa eine unvollständige antike Skulptur – auch als Torso betrachten kann, bedarf ein fragmentarisches Musikstück häufig der Vervollständigung, um aufführbar und damit erfahrbar zu werden. Etliche berühmte Werke der Musikgeschichte sind nur in Rekonstruktionen oder Vervollständigungen Dritter aufführbar: Man denke an die große c-Moll-Messe (Carus 51.651) und das Requiem (u.a. Carus 51.652) von Mozart – zwei Werke, deren Berühmtheit sich zu einem guten Teil sogar auf ihren fragmentarischen Charakter und der Legenden darum gründet!
Zu vielen Vokalwerken Johann Sebastian Bachs liegen uns heute sowohl die autographe Partitur als auch der von Bach benutzte Stimmensatz vor. Eine komfortable Situation, die wir frühen Sammlern und Bewahren, allen vorweg Bachs zweitältestem Sohn Carl Philipp Emanuel verdanken. Nur in diesem Idealfall der Überlieferung ergibt sich ein vollständiges Bild, denn viele Details – Besetzung, Artikulation, Dynamik, Verzierung, manchmal auch der Singtext – fehlen in den Partituren und die Stimmen wiederum sind oft fehlerhaft. Dennoch: Wenn Partitur und Stimmen überliefert sind, fällt es nicht so schwer ins Gewicht, wenn eine der Quellen defizitär ist, denn das Fehlende kann leicht aus der jeweils anderen gewonnen werden. Bei den hier näher zu betrachtenden drei Fragmenten ist entweder keine der beiden Quellen erhalten (aber andere Fassungen: BWV 80.1), nur eine Quelle, und die fragmentarisch (BWV 197.1) oder gar beide Quellen, aber beide unvollständig (BWV 190.1). Und: Es hat sich jeweils auch keine Abschrift des einst vollständigen Zustands erhalten.
Dr. Uwe Wolf ist als Musikwissenschaftler vor allem im 17. und 18. Jahrhundert zuhause. Seine Arbeitsschwerpunkte reichen von der Zeit Monteverdis und Schütz über Bach und die Generation der Bach-Söhne und -Schüler bis hin zur Wiener Klassik. Seit Oktober 2011 leitet er das Lektorat des Carus-Verlags. Zuvor war er über 20 Jahre in der Bach-Forschung tätig.
Johann Sebastian Bach
Ein feste Burg ist unser Gott
Kantate zum Reformationsfest, Rekonstruktion Klaus Hofmann
BWV 80 (BWV3 80.3)
Die Kantate Alles, was von Gott geboren BWV 80.1 (früher BWV 80a) ist die Urform der bekannten Kantate zum Reformationsfest Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80.3, von deren direktem Vorläufer, der ersten Fassung der Reformationskantate BWV 80.2 (früher 80b), nur ein einzelnes autographes Blatt mit einem schlichten Choralsatz statt des späteren Choralchors als Eingangssatz und dem Anfang des 2. Satzes überliefert ist. Dass diese beiden Leipziger Fassungen der Reformationskantate hingegen einen Weimarer Vorläufer haben, belegt der gedruckte Text einer Kantate zum Sonntag Oculi 1716 des Weimarer Hofpoeten Salomon Franck. Er entspricht weitgehend dem Text der Reformationskantaten, es fehlen allerdings – abgesehen vom Schlusschoral – die Choralstrophen. Es gibt somit auch keinen Hinweis darauf, dass der ausgezierte cantus firmus im Eingangssatz der Oculi-Kantate (Satz 2 der Reformationskantate) gesungen worden wäre; wahrscheinlich wurde er nur instrumental vorgetragen, gab aber durch die Wahl des bekannten Lutherlieds den Ausschlag für die spätere Umarbeitung zur Reformationskantate. In Ihrer Form als Kantate zum Sonntag Oculi hätte Bach sie in Leipzig auch gar nicht verwenden können, den dort gab es an Oculi in der Fastenzeit keine Kantatenaufführungen. Mit Hilfe des Textdruckes, dem autographen Fragment und einem in Sammlungen mit Chorälen J.S. Bachs erhaltenen, passenden Satz für den Schlusschoral (BWV 303) konnte der Göttinger Bachforscher Klaus Hofmann die Fassung von 1716 mit recht hoher Sicherheit wiederherstellen – auch wenn Bach Details im Laufe des mehrstufigen Bearbeitungsprozesses geändert haben mag.
Die Kantate Ehre sei Gott in der Höhe BWV 197.1 (197a) ist ebenfalls vollständig nur in einem Textdruck im sogenannten „Picander-Jahrgang“ von 1729 erhalten. Die Originalstimmen sind alle verloren und auch von der Partitur ist nur der letzte Papierbogen überliefert, der den Schluss der Arie Nr. 4 sowie die Sätze 5–7 enthält. Die Arie Nr. 4 – vielleicht eine der schönsten Arien Bachs überhaupt – hat Bach später in der Hochzeitskantate BWV 197.2 erneut verwendet. Die Hochzeitskantate hilft somit bei der Rekonstruktion dieses Satzes, leider aber nicht bei den fehlenden Sätzen 1–3 der Weihnachtskantate. Zu Satz 1 gibt es allerdings schon lange eine heiße Spur: Der 1. Satz des Gloria der h-Moll-Messe (Carus 31.232/01) enthält nicht nur – allerdings auf lateinisch – denselben Text wie der Eingangschor unserer Kantate, sondern steht bereits seit 1992 (Alfred Dürr) in Verdacht, eine Parodie, also ein umtextierte Bearbeitung, des Kopfsatzes unserer Weihnachtskantate zu sein: Bachs Autograph des Gloria ist für eine Erstniederschrift viel zu sauber geschrieben und es finden sich vor allem Korrekturen in den vier hohen Vokalstimmen (Sopran I, II, Alt und Tenor), die den Eindruck erwecken, dass hier ein vierstimmiger Satz zur Fünfstimmigkeit erweitert wurde. Der Niederländische Organist und Musikwissenschaftler Pieter Dirksen hat nun erstmals versucht, das Gloria anhand der Korrekturen im Autograph in die vierstimmige Form des Kantatensatz rückzuführen und den deutschen Text zu unterlegen; beides funktioniert überraschend gut.
Johann Sebastian Bach
Ehre sei Gott in der Höhe, Rekonstruktion Pieter Dirksen
BWV 197a (BWV3 197.1)
Carus 31.402/00
Vergleichbare Indizien fehlen allerdings für die Sätze 2–3. Für die Arie Satz 2 hat Dirksen nach einer zeitlich nicht zu weit entfernten, möglichen Parodievorlage Ausschau gehalten. Fündig geworden ist er in der Tenor-Arie „Verstummt, ihr holden Saiten“ aus der Trauerode BWV 198 von 1729, ein Satz der zudem auch von Tonart und Besetzung gut passt; dennoch bleibt die Parodiebeziehung freilich (plausible) Spekulation. Ganz sicher verloren ist das Rezitativ Satz 3, denn Rezitative eignen sich nicht für die Parodie. Um dennoch nicht völlig frei irgendetwas zu erfinden, griff Dirksen auf das zu Anfang fast gleichlautende Accompagnato aus BWV 174 zurück (ebenfalls aus dem „Picander-Jahrgang“). Zwar musste er die Fortführung des Accompagnatos neu erfinden, aber so konnte er von echt Bachscher Musik zumindest ausgehen.
Wie bei manchen Kantatenpartituren Bachs wurde der Schlusschoral im autographen Fagment von BWV 197.1 aus Platzgründen stiefmütterlich behandelt: Der Platz war so knapp, dass Bach auf nur 2 Systemen lediglich textlos den Vokalsatz notieren konnte. Der Text ist aus dem Textdruck leicht zu ergänzen, doch die festliche Disposition der Kantate mit Trompeten und Pauken im Eingangssatz macht es unwahrscheinlich, dass diese im Schlusschoral zu schweigen hatten, sie waren also ebenfalls (nach ja zahlreichen Vorbildern) zu ergänzen.
Mit dem Accompagnato und den Trompeten des Schlusschorals haben wir die Bahnen philologischen Rekonstruierens bereits in Richtung Komposition verlassen. Und kompositorische Fähigkeiten sind bei der letzten der drei Kantaten gefragt, der Neujahrskantate BWV 190.1. Erhalten haben sich gleich zwei fragmentarische Quellen: Eine autographe Partitur, die aber nur die Sätze 3–7 enthält, und ein Stimmensatz, der nur noch aus den vier Singstimmen sowie zwei Violinstimmen besteht. Der ebenfalls erhaltene, originale Umschlag gibt Auskunft über die Gesamtbesetzung: „à 4 Voc:, 3 Clarini, 1 Tamburi, 3 Hautbois, Bassono, 2 Violini, Viola, con Continuo“. Es fehlen also 3 Trompeten, Pauken, 3 Oboen, Fagott, Viola und die Continuo-Stimmen.
Bei Satz 2 ist der Verlust offenbar klein: Trompeten und Pauken hatten sicher zu schweigen und wenn die Holzbläser zu beteiligen gewesen wären, dann höchstens in den Choralteilen colla parte mit den Singstimmen wie es auch in den erhaltenen Violinstimmen notiert ist und sicher auch für die Viola anzunehmen ist. Es fehlt also „nur“ die Continuo-Stimme. In den Choralteilen dieses Rezitativs mit Choral, stellt auch dies kein großes Problem dar (Continuo geht mit dem Vokalbass), in den rezitativischen Teilen allerdings muss zur einzig erhaltenen Singstimme der Bass – und damit der harmonische Vorlauf – ergänzt werden; eine kompositorische Aufgabe, der sich der Cembalist und Komponist Massato Suzuki zusammen mit seinem Vater, dem japanischen Bach-Dirigenten Masaaki Suzuki angenommen hat.
In Satz 1 ist die kompositorische Aufgabe noch einmal deutlich komplexer, da ein Großteil des Instrumentalapparats hinzukomponiert werden musste, eine Aufgabe, die sowohl einen Kenner Bachscher Musik als auch einen versierten Komponisten erfordert. Und eine Aufgabe, die immer nur eine Annäherung darstellen kann, denn die Verluste lassen viel Spielraum zu unterschiedlichen Lösungen.
Johann Sebastian Bach
Singet dem Herrn ein neues Lied
Kantate zum Neujahrstag, Rekonstruktion Masaaki und Masuto Suzuki
BWV 190 (BWV3 190,1)
Carus 31.190/00
Gerade die Kantate Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 190.1, die Kantate mit den vielleicht größten Spielräumen und Unsicherheiten unter den hier vorgestellten Kantaten, hat immer wieder neu zu Rekonstruktionen angeregt, deren erste bereits vor über 100 Jahren entstand. Aber muss man wirklich fragmentarische Werke rekonstruieren? Genügen die erhaltenen Werke nicht? Von den Fragmenten geht ein besonderer Reiz aus; es ist Musik die zum Greifen nah scheint, aber doch verloren ist. Und es sind Rätsel, die gelöst werden wollen! Trotzdem, nicht um ein Werk zu rekonstruieren, aber wohl um eine Rekonstruktion zu veröffentlichen braucht es mehr als nur den Reiz des Rätsels. Es muss dem Wiederherzustellenden etwas Besonderes anhaften, es muss das aufführbare Œuvre um eine eigene Note erweitern. Und in der Rekonstruktion muss Bach spürbar sein, es muss also genügend originales Material vorhanden sein, um ein sinnvolles Rekonstruieren zu erlauben! All dies ist bei weitem nicht bei allen Rekonstruktionen der Fall, die heute hier und da zu hören sind. Den Rekonstruktionen der vorliegenden CD/des Konzerts ist dies aber vollends und bei jeder Kantate auf andere Art und Weise zu bescheinigen.

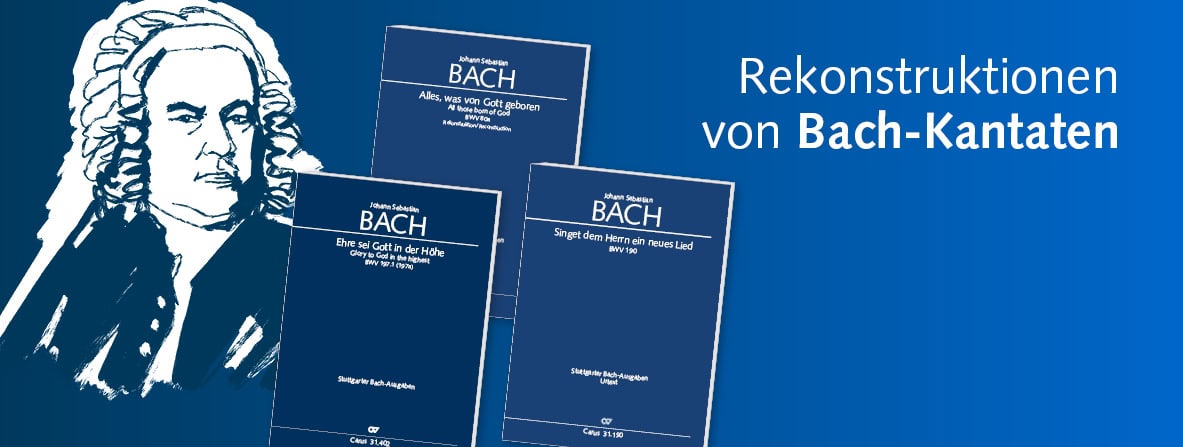

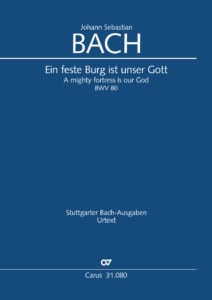
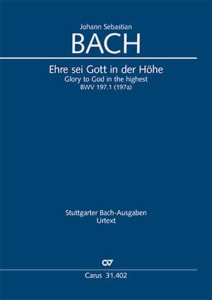
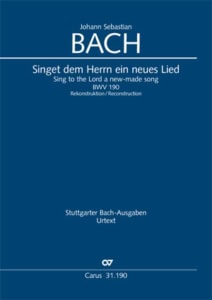
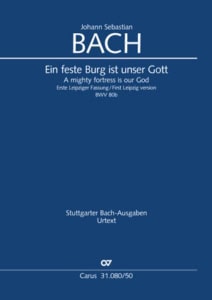 Die vom Carus-Verlag erstmals in praktischer Ausgabe vorgelegte erste Fassung der Reformationskantate Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80b war der Bach-Forschung bis weit ins 20. Jahrhundert unbekannt geblieben. Zeugen ihrer einstigen Existenz sind drei Fragmente des ersten Blattes der Bach’schen Partitur, die in die Jahre 1728-1731 datiert werden. Die dagegen seit langem bekannte erweiterte Neufassung der Kantate mit ihrem mächtigen Eingangschor (BWV 80) stammt aus den 1730er oder 1740er Jahren. Sie ist nur in einer Abschrift nach Bachs Partitur überliefert, die aber ihrerseits Schlüsse auf die Fassungsgeschichte zulässt und so zusammen mit den erwähnten Partiturfragmenten die Rekonstruktion der ersten Fassung ermöglicht.
Die vom Carus-Verlag erstmals in praktischer Ausgabe vorgelegte erste Fassung der Reformationskantate Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80b war der Bach-Forschung bis weit ins 20. Jahrhundert unbekannt geblieben. Zeugen ihrer einstigen Existenz sind drei Fragmente des ersten Blattes der Bach’schen Partitur, die in die Jahre 1728-1731 datiert werden. Die dagegen seit langem bekannte erweiterte Neufassung der Kantate mit ihrem mächtigen Eingangschor (BWV 80) stammt aus den 1730er oder 1740er Jahren. Sie ist nur in einer Abschrift nach Bachs Partitur überliefert, die aber ihrerseits Schlüsse auf die Fassungsgeschichte zulässt und so zusammen mit den erwähnten Partiturfragmenten die Rekonstruktion der ersten Fassung ermöglicht. 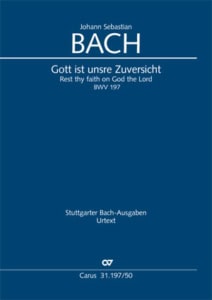
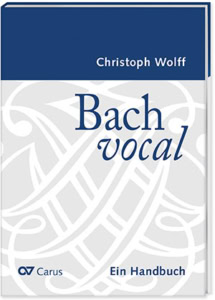


Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!