Charpentiers Kompositionstalent
Ein Franzose mit dem besten aus Italien
Charpentiers umfangreiches Œuvre – allein an kirchenmusikalischen Werken schrieb er an die 500 Einzeltitel – zeichnet sich in seiner ganzen Breite aus durch ein bemerkenswert hohes Qualitätsniveau, außerdem durch eine besondere Schönheit sehr bescheidener, unprätentiöser Art, die manchen seiner im selben Metier tätigen Zeitgenossen wohl eifersüchtig machen konnte.
Wenn der Komponist und Musiktheoretiker Sébastien de Brossard (1655–1730) im Jahre 1724, zurückblickend auf seinen zwei Jahrzehnte zuvor verstorbenen Kollegen Marc-Antoine Charpentier, über dessen Reputation in Frankreich bemerkte:
Die Beziehung zu Italien, die er in seiner Jugend pflegte, nahmen einige französische Puristen, oder besser gesagt, die, die eifersüchtig auf die Güte seiner Musik waren, als Anstoß, um ihm seinen italienischen Geschmack vorzuwerfen; denn man kann sagen, ohne ihm zu schmeicheln, dass er das Beste daraus genommen hat – seine Werke beweisen es zur Genüge,
dann umriss er damit in wenigen prägnanten Worten die Eckdaten zu Charpentiers Kompositionskunst vor allem im Blick auf ihre italienischen Wurzeln. In der Tat: Charpentiers umfangreiches Œuvre – allein an kirchenmusikalischen Werken schrieb er an die 500 Einzeltitel – zeichnet sich in seiner ganzen Breite aus durch ein bemerkenswert hohes Qualitätsniveau, außerdem durch eine besondere Schönheit sehr bescheidener, unprätentiöser Art, die manchen seiner im selben Metier tätigen Zeitgenossen wohl eifersüchtig machen konnte. Was war für die Neider naheliegender, als dem 1643 in Paris geborenen Schriftstellersohn seine Studienzeit in Italien und seinen daraus resultierenden angeblich italienischen Geschmack vorzuwerfen? Während nämlich junge Komponisten aus anderen europäischen Ländern damals in großer Zahl gerne nach Italien reisten, um dort eifrig und wissbegierig den neuen konzertanten Stil zu studieren, blieben die Franzosen im 17. Jahrhundert, bedingt wohl durch spezielle politische Konstellationen, in auffälliger Distanz zu ihren italienischen Nachbarn. Daher verwundert es nicht, dass Charpentier, ohnehin ein zurückhaltender und dezenter Mensch, nach seinem dreijährigen Rom-Aufenthalt in Paris keineswegs mit offenen Armen in der Heimat empfangen wurde: Es gelang ihm zeitlebens nicht, eine offizielle Stellung am Königshof zu erlangen, obwohl Ludwig XIV. seine Musik nachgewiesenermaßen sehr schätzte. Charpentiers schärfster Widersacher im Umfeld des Königs war ausgerechnet der gebürtige Italiener Jean-Baptiste Lully, seines Zeichens „Surintendent de la musique du Roi.“
Marc-Antoine Charpentier:
In nativitatem Domini canticum
- Partitur: Carus 21.001/00
- Klavierauszug: Carus 21.001/03
- Stimmset: 21.001/19
Charpentier war in Rom bei Giacomo Carissimi (1605–1674), dem langjährigen Kapellmeister des jesuitischen Priesterseminars Collegium Germanicum et Hungaricum, in die Lehre gegangen; für sein ganzes Leben prägte ihn das Studium bei dem hochverehrten Meister, ohne ihn freilich zu blindem Epigonentum zu verleiten: tatsächlich bezeugen, wie Brossard konstatiert, Charpentiers Werke ausdrücklich, dass er nur „das Gute“ der italienischen Stilistik übernommen und dies in eine ganz eigenständige Idiomatik eingebracht hat, deren Tonfall durch und durch französisch ist.
Wenngleich die römische Lehrzeit für Charpentier in Frankreich keine Eintrittskarte in die allerersten musikalischen Ränge bedeutete, so wirkte sich doch immerhin die in Rom entstandene Nähe zu den Jesuiten positiv auf seine Karriere aus: Zurück in Paris, trat er sogleich in den Dienst der mit den Jesuiten in regem Austausch befindlichen (und der Familie Charpentier ohnehin seit langem freundschaftlich verbundenen) Adligen Mademoiselle de Guise (Maria von Lothringen), die eine kleine, aber erstklassige Privatkapelle unterhielt. Hier wirkte Charpentier als Sänger und Komponist, und lernte wohl auch den gleichfalls jesuitisch geprägten Priester und Musiker Sébastien de Brossard kennen, der im Haus de Guise verkehrte. Außerdem bekam er eine Wohnung im Hôtel seiner Gönnerin gestellt. 1687 avancierte Charpentier dann zum Maître de musique am jesuitischen Collège Louis-le-Grand, kurz darauf auch an der Jesuitenkirche Saint-Louis. 1698 schließlich erreichte Charpentiers Karriere ihren Höhepunkt: Er wurde Maître de musique an der Sainte-Chapelle, wo er die Chorknaben zu unterrichten und mit Musik aus seiner Feder zu versorgen hatte.
Marc-Antoine Charpentier:
In circumcisione Domini
- Partitur: Carus 21.019/00
- Bearbeitung für Chor & Orgel:
Carus 21.019/03
Zu den italienischen Spezifika, die Charpentier in Rom aufgriff und seinem eigenen Stil anverwandelte, gehört auf Gattungsebene das in Frankreich bis dato praktisch unbekannte Oratorium, als dessen führender Meister Carissimi in jener Zeit gelten durfte. Im Oratorium werden biblische Themen in dialogischer Form, also per Vortrag mit verteilten Rollen, aufbereitet; als Basis dient Bibeltext (bei Carissimi wie auch bei Charpentier in lateinischer Sprache nach der Vulgata), der jedoch häufig leicht verändert und durch geistliche Dichtung ergänzt wird. Rezitativische und ariose Abschnitte wechseln einander ab; ein Historicus, dessen Partie auch mehrstimmig gesetzt sein kann, fungiert als Erzähler der in den Fokus genommenen biblischen Begebenheit, außerdem sind die Rollen des vorkommenden Personals solistisch oder auch chorisch besetzt. Der Kompositionsstil ist konzertant; das begleitende Instrumentarium umfasst außer dem Basso Continuo zumeist auch obligat geführte Violinen, nicht selten zusätzlich Flöten, die in den ariosen Abschnitten mit den Sängern dialogisieren. Von Charpentier sind 35 solcher oratorischen Kompositionen unterschiedlichster Länge und Ausarbeitung überliefert; sie können mit einem Oberbegriff als Histoires sacrées bezeichnet werden. Charpentier war im 17. Jahrhundert wohl der einzige Komponist in Frankreich, der diese Gattung bediente, und er hatte darin auch keine unmittelbaren Nachfolger.
Zu den frühesten Histoires sacrées von Charpentier gehören vier Stücke für den Weihnachtsfestkreis, die Charpentier offenbar 1676/77 für einen gemeinsamen Anlass komponiert hat: H 393 Canticum in nativitatem Domini (Frigidae noctis umbra) für die Heilige Nacht, H 316 In circumcisione Domini (Postquam consummati sunt dies octo) für den Neujahrstag, H 395 Pour la fête de l’Epiphanie (Cum natus esset Jesus in Bethlehem Juda) und H 318 In festo purificationis (Erat senex in Jerusalem, cui nomen Simeon) für das Fest Mariae Reinigung (Lichtmess). Obwohl die vier Histoires äußerlich auf denselben Rahmenbedingungen basieren – sie sind alle mit drei Vokalstimmen (2 Soprane und Bass), zwei obligaten Instrumentalstimmen und Basso continuo besetzt –, erweisen sie sich in ihrer individuellen Anlage als recht vielfältig: Die Partie des Historicus ist teils mit einem Sänger, teils mit zweien oder dreien besetzt. Im Falle der einfachen Besetzung tendiert die Satzart stärker zum reinen Rezitativ, im Falle der mehrfachen Besetzung ist sie naturgemäß gebundener, oft ins Ariose mündend. An weiterem biblischen Personal begegnen dem Hörer u. a. der greise Simeon, Herodes, ein Engel oder die Weisen aus dem Morgenland. Drei der vier Histoires enthalten gereimte, strophische Lobpreispoesie, die Charpentier unter Bündelung des gesamten Aufführungsapparates mit liedhaft-schlichter Lieblichkeit sehr effektvoll vertonte. Gemeinsam ist allen Werken die große Nähe der musikalischen Ausgestaltung zum Textdetail: Aussagekräftig führt etwa die Melodielinie des Historicus stufenweise abwärts, wenn von den „Frigidae noctis umbra“ (Schatten der kühlen Nacht) die Rede ist. Die Weisen aus dem Morgenland deklamieren das Wort „rex“ (König) stets auf einem schmerzhaft dissonanten übermäßigen Dreiklang, als ahnten sie bereits die scharfe Diskrepanz zwischen der weltlichen und der heilsgeschichtlichen Bedeutung dieses Begriffes voraus; ihre Verneigung vor dem Kind, dem sie im Stall zu Bethlehem huldigen, findet ebenso plastisch musikalischen Niederschlag wie die tiefe ehrfürchtige Rührung, von der sie bei ihrer Begegnung mit dem Erlöser ergriffen werden.
Den Text des ersten dieser vier Werke griff Charpentier in leicht veränderter Gestalt für ein weiteres Weihnachtskonzert (H 421) im Jahr 1698 oder 1699 noch einmal auf; die musikalische Faktur, vor allem die auffällig hohe Lage der drei im Diskantbereich angesiedelten Gesangsstimmen, verweist auf die Bestimmung dieses Stückes: Es wurde offensichtlich für die Knaben der Sainte-Chapelle komponiert.
Marc-Antoine Charpentier In festo purificationis
- Partitur: Carus 21.020/00
- Bearbeitung für Chor & Orgel:
Carus 21.020/03
Marc-Antoine Charpentier:
In nativitate Domini nostri Jesu Christi canticum
Carus 21.002
Marc-Antoine Charpentier:
Magnificat
Carus 21.003
In stilistischer Nähe zu den Histoires sacrées steht das um 1670 komponierte Weihnachtskonzert H 314 In nativitatem Domini canticum (Quem vidistis, pastores); sein Text beruht auf einer Stundengebets-Antiphon, die durch Tropierung zu einer Betrachtung des weihnachtlichen Heilsgeschehens erweitert wurde, und wird ergänzt durch Einzelverse aus Psalm 97 (98). Da es in diesem Stück keinen biblischen Bericht gibt, kommt die rezitativische Setzweise nicht vor; die vier Vokal- und zwei obligaten Instrumentalstimmen agieren, unterschiedlich kombiniert, ausschließlich in konzertantem Satz miteinander.
Um eine Komposition für eine feierliche Vesper in der Jesuitenkirche St.-Louis könnte es sich bei dem Magnificat H 80 handeln, dessen Entstehungszeit wohl um 1690 zu vermuten ist. Das mit vier Vokalsolisten, vierstimmigem Chor und Basso continuo besetzte Stück ist durchkomponiert, wobei die Versgrenzen jeweils durch einen Wechsel der Besetzung oder zumindest der Satzart markiert werden. Der chorisch beginnende Vers „Esurientes implevit bonis“ (die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben) allerdings zieht nach sinnfälligem solistischem Ausklang (et divites dimisit inanes/und lässt die Reichen leer ausgehen) eine charakteristische Generalpause nach sich.
Das Programm der CD Noëls – Weihnachtskantaten wird ergänzt durch eine Reihe von reizvollen instrumentalen Noëls, Weihnachtsliedern also, gesetzt für Streicher, Flöten und Basso continuo. Diese in zwei Gruppen überlieferten Werke sind vermutlich in den frühen 1690er Jahren entstanden. Charpentier entfaltet in diesen bewusst einfach gehaltenen Stücken auf kleinem Raum seine Kunst des schlichten Harmonisierens, der effektvollen Abstufung von Stimmenzahl und Klangfarben sowie der organischen formalen Anlage.
Marc-Antoine Charpentier
Noël. Weihnachtskantaten
Carus 83.196


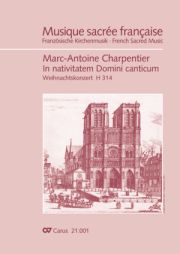






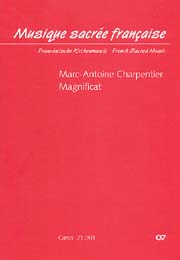
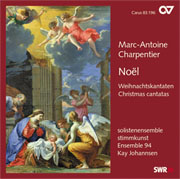


Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!