Gaetano Donizettis Messa di Requiem
im Spannungsfeld der italienischen Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts
Italien als Wiege der Oper ist weit bekannt. Leicht gerät in den Hintergrund, dass dort auch die Kirchenmusik stets einen hohen Stellenwert hatte. Sie bildet das Fundament auf dem sich alles entwickeln konnte. Carus-Herausgeber Guido Johannes Joerg beleuchtet eine beeindruckende kirchenmusikalische Tradition!
Durch die Omnipräsenz der Oper im italienischen Musikbetrieb gerät leicht in den Hintergrund, dass in Italien stets eine lebendige kirchenmusikalische Musikausübung praktiziert wurde. Kinder erhielten ihre musikalische Ausbildung meist in Kirchenchören und durch Kirchenmusiker. Die professionelle Weiterbildung geschah an Musikschulen, die oft auf eine kirchliche Vorgängerinstitution zurückreichten. Die frühesten Werke angehender Komponisten waren geistliche; gelegentlich sogar vollständige Messen. Und als Abschlussarbeit eines Harmonielehre- und Kontrapunktstudiums wurde vielerorts eine Messkomposition verlangt. Einige Beispiele aus dem 19. Jahrhundert: Rossini und Bellini komponierten jeweils mehrere Messen, bevor sie sich an ihre erste Oper wagten. Donizetti schuf noch in Bergamo etliche Dutzend geistliche Werke. Verdi, Puccini oder Catalani schlossen ihr Studium mit einer Messkomposition ab.
Diejenigen Musiker, die nicht für die Oper gemacht waren und/oder der Ochsentour nicht gewachsen waren, die der Opernbetrieb erforderte, fanden Anstellung vornehmlich in der Institution Kirche (sehr viel rarer waren Stellungen an Fürstenhöfen). Mancher zeitweilig erfolgreiche Opernkomponist nahm – nachdem sein Stern ins Sinken geriet – eine Stellung als Kirchenmusiker an. Andere wechselten zwischen Oper und Kirche hin und her oder wirkten sogar erfolgreich in beiden Welten. Verdi hatte eine erste Anstellung als Organist in Busseto angenommen, nachdem er als Knabe in Le Roncole bereits den Dorforganisten vertreten hatte.
Die Kirchenmusik war also immer präsent, auch wenn sie in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit eher im Schatten der Oper stand. Hervorragende Musiker und Pädagogen wirkten im kirchlichen Bereich, es existierten überall gut geschulte Chöre, aus denen ausgezeichnete Solisten hervorgingen – und eine solide finanzielle Ausstattung erlaubte nicht selten Aufführungen sogar mit Gästen und einem großen Orchester. Das Repertoire, das unter diesen erstaunlich guten Bedingungen entstand, ist beeindruckend – auch wenn im heutigen Musikbetrieb bloß einige Spitzen jenes Eisbergs hervorragen. Einigen Einschränkungen mussten sich die Kirchenmusiker freilich auch beugen: So bedingte etwa die Tradition, nach welcher Frauenstimmen in der Kirchenmusik nicht geduldet waren, die Besetzung von Solo- und Chorstimmen mit Knaben- und Männerstimmen. Auch Donizettis schrieb in seiner Messa di Requiem (Carus 27.322) keine virtuosen Arien für Sopran- oder Altstimme; diese werden vornehmlich im solistischen Ensemble verlangt, so dass sie auch Knaben anvertraut werden konnten. Wem – wie Donizetti – hervorragende Frauensolistinnen von der Opernbühne her vertraut waren, mochte Arien wohl nicht von Knabenstimmen ausgeführt hören. Rossini wandte sich in den 1860er-Jahren an Papst Pius IX., da seine Petite Messe solennelle (Carus 40.650) nicht von unreinen Knabenstimmen aufgeführt werden sollte. Seine Eingaben an Pius IX. hatten keinen Erfolg. Verdi vermochte sich bei seiner Messa da Requiem (Carus 27.303) über das päpstliche Verbot hinwegzusetzen, weil das liberale Mailand kaum dem Einfluss des einst mächtigen Kirchenstaates unterlag (der sich 1870 auf den Vatikan hatte beschränken müssen) und das Werk – obzwar de facto in einer Kirche uraufgeführt – doch der Öffentlichkeit erst drei Tage später am Teatro alla Scala präsentiert wurde.
Donizettis Messa di Requiem, geschaffen als Reaktion auf den unerwarteten Tod des nicht einmal 34jährigen Vincenzo Bellini im September 1835, ist eine jener Spitzen des Eisbergs „Italienische Kirchenmusik“, die hervorragt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Vergleich zu anderen Spitzen – etwa Rossinis Stabat mater (Carus 70.089) und Petite Messe solennelle, Verdis Messa da Requiem oder Puccinis Messa di Gloria (Carus 56.001/01), – ist jene Totenmesse freilich recht wenig bekannt, was den unglücklichen Umständen ihrer Entstehung und Rezeption geschuldet sein dürfte. Die Neuausgabe des Carus-Verlags bietet nun beste Voraussetzungen für eine verstärkte Rezeption, die dem Meisterwerk der Gattung auch gerecht wird.
Eindringliche Chorsätze und beeindruckende Fugen, einfühlsame Soloarien und mehrere solistische Ensemblesätze zeichnen Donizettis Requiem aus. Die Musik ist durchwegs sakral empfunden und verrät nur an wenigen Stellen den Opernkomponisten als Urheber. Auf ohrwurmtaugliche Melodien wird trotzdem nicht verzichtet. Die Instrumentation ist geschickt und fantasievoll. Donizetti gelang ein sehr eigener Zugang zur Gattung. Trotzdem fügt er sich in die Tradition des Requiems im Italien im 19. Jahrhundert ein. Von Mozarts Requiem (ergänzt von Franz Xaver Süßmayr, Carus 51.626 und von Robert D. Levin, Carus 51.626/50) und stärker noch von Luigi Cherubinis Requiem c-Moll (Carus 40.086) von 1816/17 ließen sich nahezu alle nachfolgenden italienischen Komponisten inspirieren. Auf Donizetti dürfte auch Mayrs Gran Messa da Requiem g-Moll von 1815 gewirkt haben, hatte er doch 1819 selbst bei einer Aufführung des Werks in Santa Maria Maggiore in Bergamo mitgewirkt. So gelang ihm ein vollständiges, großes und durchkomponiertes Meisterwerk der Gattung der Totenmesse, deren Musik geistliche und opernhafte Züge vereint. In ihrer Faktur äußert sich die Auseinandersetzung des Komponisten mit dem seinerzeit noch lebendigen geistlichen Stil, den Giovanni Simone Mayr für Bergamo geschaffen hatte, und mit der liturgisch-musikalischen Praxis des frühen 19. Jahrhunderts.
Die Neuausgabe erlaubt einen unverstellten Blick auf das Original von 1835 – befreit von den Anhaftungen und Abschleifungen anderer Zeiten. Die modernen editorischen und aufführungspraktischen Erwägungen folgende Partitur sowie das dazugehörige Aufführungsmaterial mögen Donizettis Messa di Requiem einen vorbehaltlosen Neubeginn ermöglichen. Das Meisterwerk verdient erheblich mehr Würdigung im Werkverzeichnis des Komponisten, eine wesentlich breitere Rezeption im Musikbetrieb unserer Epoche, in Italien, Europa und international, als ihm bislang zugestanden wurde.
Messa di Requiem
Gaetano Donizetti
Carus 27.322
Gioachino Rossini
Giuseppe Verdi
Gioachino Rossini
Als Herausgeber hat Guido Johannes Joerg zahlreiche vergessene Kompositionen wiederbelebt, mit einem Schwerpunkt auf italienischer Musik des „langen“ 19. Jahrhunderts. Er war an der Rossini-Renaissance beteiligt, auch mit mehreren Rossini-Ausgaben bei Carus.


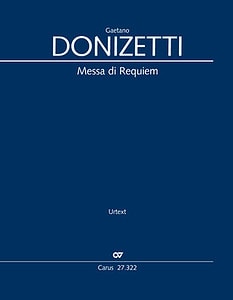
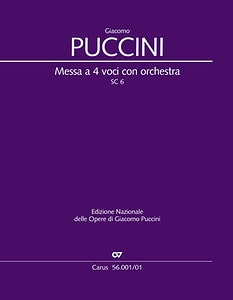

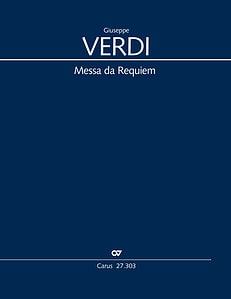
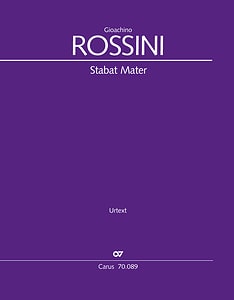
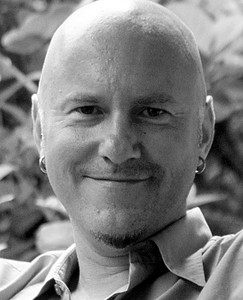

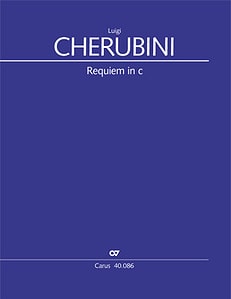



 © Elisabeth Wiesner
© Elisabeth Wiesner
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!