Schwanengesang: Die Vertonung des 119. Psalms von Heinrich Schütz
Deine Rechte sind mein Lied
Heinrich Schütz betrachtete sein letztes Werk als eine tiefgreifende künstlerische Botschaft und taufte es seinen „Schwanengesang“. Das Meisterwerk versank jedoch für Jahrhunderte in Vergessenheit, bis um 1900 Teile der handschriftlichen Stimmbücher wieder ans Licht kamen. Nach ersten Rekonstruktionen in den 1970er Jahren präsentiert die Edition der Stuttgarter Schütz-Ausgabe, basierend auf den erhaltenen Quellen, eine eigene Gestalt des „Schwanengesangs“.
Das alttestamentliche Buch der Psalmen in der Übersetzung Martin Luthers ist für Heinrich Schütz die mit Abstand wichtigste Textquelle. Schütz’ früheste Bibeltextvertonung ist der dreichörige 100. Psalm (SWV 36a), der dann 1619 in revidierter Fassung in die Drucksammlung Psalmen Davids einbezogen wurde, und am Ende seines Œuvres steht der 119. Psalm (Carus 20.918/00), sein sogenannter „Schwanengesang“, den Schütz 1671, also ein Jahr vor seinem Tode, noch abschließen konnte. Dazwischen entstanden weit über 100 Psalmtext-Vertonungen, denen zum Teil einzelne Verse oder Versgruppen, vielfach aber auch ganze Psalmen zugrundeliegen.
Die Liebe des Komponisten Schütz zum Psalter erklärt allerdings noch nicht, warum er in höchstem Alter den 119. Psalm auswählte, der nicht nur die exzessive Länge von 176 Versen hat, sondern dem auch der Bilderreichtum fehlt, der Dichtungen wie den 23. oder den 121. Psalm für Komponisten so attraktiv gemacht hat (Schütz hat beide je zweimal vertont). Vielleicht ging die Anregung zur Vertonung von Psalm 119 von einem Vers aus, der Schütz besonders nahestand. Es ist der 54. Vers, der für ihn zum Leitwort seines Lebens als Komponist geistlicher Musik geworden war: „Deine Rechte sind mein Lied in meinem Hause.“ Die „Rechte“ Gottes (neuere Übersetzungen sprechen von „Satzungen“ oder „Ordnungen“) werden – das ist die Aussage – durch den Komponisten in ein „Lied“, d. h. in Musik, verwandelt. Schütz benutzte diesen Vers mehrmals als als Eintrag in Stammbücher („Freundschaftsalben“), und in seinen späten Weißenfelser Jahren hat er ihn, wie ein Besucher berichtet hat, an der Wand seiner Komponierstube anbringen lassen. In Teil 4 des 119. Psalms zieht Vers 54 durch besonders eindringliche Vertonung die Aufmerksamkeit auf sich.
Prof. Dr. Werner Breig war Professor für Musikwissenschaft an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe, anschließend bis 1988 an der Bergischen Universität Wuppertal und danach bis 1997 an der Ruhr-Universität Bochum. Schwerpunkte seiner Forschungen sind die Musik von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und Richard Wagner.
Heinrich Schütz
Der 119. Psalm
Schwanengesang
Gesamtausgabe Bd. 18
Carus 20.918/00
Von „Ordnung“ bzw. „Rechten“ spricht nicht nur dieser Vers; vielmehr durchziehen diese und synonyme Begriffe den ganzen Psalm in vielfacher Wiederholung. Eine strenge formale Ordnung bestimmt auch die Anlage und Länge des 119. Psalms, er ist nämlich als sogenanntes Akrostichon geformt, d. h. die Anfangsbuchstaben seiner Verse sind einer Regel unterworfen. Und zwar beginnen im Originaltext alle acht Verse der ersten Strophe mit „Aleph“, die acht Verse der zweiten mit „Beth“ und so fort, bis alle 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets achtmal als Initialen gedient haben. (In Übersetzungen geht das Akrostichon natürlich verloren.) Als Gesamtzahl der Verse ergibt sich so die Zahl 176 (22 x 8).
In der theologischen Literatur wird diese Gestaltung vielfach als gekünstelt kritisiert, da die Form den Inhalt zu überwuchern scheint. Unter den Theologen des 20. Jahrhunderts war es Dietrich Bonhoeffer, der darüber anderer Meinung war. Der 119. Psalm stand ihm besonders nahe; er nannte ihn seinen „liebsten Psalm“. In seiner Fragment gebliebenen Meditation zu Psalm 119 gab Bonhoeffer denen, die Schwierigkeiten mit der Länge und den vielen Wiederholungen hatten, den Rat: „Hier hilft uns ein ganz langsames, stilles, geduldiges Fortschreiten von Wort zu Wort, von Satz zu Satz. Dann erkennen wir, daß die scheinbaren Wiederholungen doch immer neue Wendungen der einen Sache sind, der Liebe zu Gottes Wort.“
Wie reagierte der Komponist Schütz auf diesen nicht eigentlich musikfreundlichen Text? Zunächst verdichtete er die 22 Teile der akrostichischen Gesamtform auf elf, indem er jeweils zwei achtversige Textstrophen zu einem Teil verband. Jeder Teil erreichte so die übliche Länge einer Motette. Diese Gliederung wird noch dadurch verdeutlicht, dass jeder Teil in eine „kleine Doxologie“ („Ehre sei dem Vater und dem Sohn …“) mündet. Sowohl der Psalmtext als auch die Doxologie werden jedes Mal als ein Neuanfang gestaltet, indem sie mit einer einstimmigen Intonation beginnen – ein Rückgriff auf die liturgische Einstimmigkeit, der in Schütz’ vorangehenden Werken nur sehr selten vorkommt (so etwa dreimal in den Musikalischen Exequien (Carus 20.908)).
Schütz gibt dem Text eine musikalisch lebendige Gestalt, verzichtet dabei bemerkenswerterweise weitgehend auf starke äußerliche Kontraste oder Buntheit, wie man sie aus den Psalmen Davids kennt. Das 13-teilige Werk hat eine Grundbesetzung von zwei vierstimmigen Chören und einer Orgelbegleitung, die meist nach dem Prinzip des Basso seguente gestaltet ist, also keine selbstständige Funktion hat. Es gibt keine Konfrontation von Hoch- und Tiefchor, von solistischen und chorischen Partien, keine obligaten Instrumente. Schütz komponierte den Text – man möchte Bonhoeffer zitieren – in geduldigem „Fortschreiten von Wort zu Wort, von Satz zu Satz“ – natürlich mit der musikalischen Verlebendigung des Sprachtextes, wie sie für Schütz selbstverständlich ist.
Allerdings hat Schütz sich die Wiedergabe farbiger vorgestellt, als es im Notentext ausgedrückt ist, denn er hat seinen Schüler Constantin Christian Dedekind gebeten, zu den Vokalstimmen ad libitum Instrumente hinzuzufügen. Dabei schwebte ihm anscheinend etwas vor wie die Zusatzchöre („Capellae“) in seinem ersten Psalmen-Opus, den Psalmen Davids von 1619. Schütz’ Wunsch wurde zwar von Dedekind nicht erfüllt, da er sich „dessen kühnlich nicht anzumaßen“ wagte; doch sind heutige Interpreten dadurch angeregt, die Gesangslinien durch streckenweise mitgehende Instrumente zu färben.
Heinrich Schütz
Schwanengesang
Complete recording Vol. 16
(Rademann)
Carus 83.275/00
Schütz’ letztes Opus enthält außer dem elfteiligen 119. Psalm zwei bereits etwas früher entstandene Werke, eine Vertonung des 100. Psalms und ein deutsches Magnificat. Schütz wollte sie offenbar dadurch in sein Gesamtwerk einbinden und nach Möglichkeit durch den Druck vor den Zufälligkeiten der handschriftlichen Überlieferung sichern. Aus Schütz’ Umgebung wird berichtet, dass er selbst das Opus als seinen „Schwanengesang“ bezeichnete, offenbar weil er in ihm seine letzte und besonders bedeutsame künstlerische Botschaft sah. Das gedruckte Titelblatt allerdings formulierte er, seiner Gepflogenheit entsprechend, „sachlich“ und nannte nur die Textgrundlagen seiner Komposition.
Dieses Titelblatt und das Inhaltsverzeichnis sind die einzigen Werkteile, die zu Schütz’ Lebzeiten gedruckt wurden. Der Notentext dagegen wurde nur in handschriftlichen Stimmbüchern festgehalten. Diese enstanden, wie wir aus Eintragungen von der Hand des Komponisten ersehen können, in der Umgebung von Schütz und wurden offensichtlich von einem geschulten Musiker hergestellt, in dem wir mit einiger Wahrscheinlichkeit Schütz’ Schüler Constantin Christian Dedekind erkennen können.
Unter allen Schütz-Quellen hat diese Handschrift das wechselvollste Schicksal erlitten, und nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass wir sie (genauer: ihren größeren Teil) noch besitzen. Nach Schütz’ Tod im Jahre 1672 wurde das Material vermutlich im kurprinzlichen Schloss zu Dresden aufbewahrt. Dort wäre es bei der Beschießung durch preußische Truppen im Jahre 1760 wohl zugrundegegangen, wenn es nicht nach dem niederschlesischen Guben verlagert worden wäre, das dem musikinteressierten Herzog Christian von Sachsen-Merseburg (1615–1691) unterstand, der mit Schütz persönlich bekannt war. Dort lagerte es in der Bibliothek der Haupt- und Stadtkirche und geriet für lange Zeit in Vergessenheit.
Heinrich Schütz
Der 119. Psalm
Schwanengesang
Klavierauszug
Carus 20.918/03
Als Philipp Spitta seine Schütz-Gesamtausgabe veröffentlichte (1885–1894), war ihm zwar aus dem Schütz-Nekrolog von Martin Geier bekannt, dass Schütz in seinen letzten Lebensjahren den 119. Psalm komponiert hatte; er konnte aber nur feststellen, dass er nichts über dieses Werk wusste. Genaueres erfuhr man erst, als im Jahre 1900 der Straßburger Theologe Friedrich Spitta (der jüngere Bruder Philipp Spittas) in der Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst mitteilen konnte, dass in Guben sechs Stimmbücher eines monumentalen doppelchörigen Werkes von Heinrich Schütz gefunden worden waren, das aus einer elfteiligen Vertonung von Psalm 119 und einem zweiteiligen Anhang (Psalm 100, Deutsches Magnificat) bestand. Von den acht Singstimmen des Werkes waren schon damals zwei nicht mehr vorhanden und sind auch später niemals bekannt geworden. Auch die Organo-Stimme fehlte; sie gelangte allerdings später durch den Autographenhandel in die Sammlung von Stefan Zweig und befindet sich heute in dessen Nachlass in der British Library in London. Friedrich Spitta konstatierte, dass das Erhaltene es zwar erlaube, „die Größe des Verlustes ganz zu ermessen“, konnte sich aber angesichts des fragmentarischen Zustandes der Quelle offensichtlich nicht vorstellen, dass das Werk in die musikalische Praxis eingehen könnte.






 Mit seiner Auferstehungshistorie setzte Schütz die etwa siebzigjährige Tradition der Komposition biblischer Historien fort, die Friedrich Blume die „eigenartigsten und geschichtlich bedeutendsten Leistungen der protestantischen Musik“ genannt hat.
Mit seiner Auferstehungshistorie setzte Schütz die etwa siebzigjährige Tradition der Komposition biblischer Historien fort, die Friedrich Blume die „eigenartigsten und geschichtlich bedeutendsten Leistungen der protestantischen Musik“ genannt hat. 
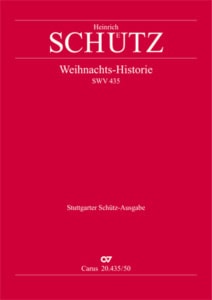




Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!